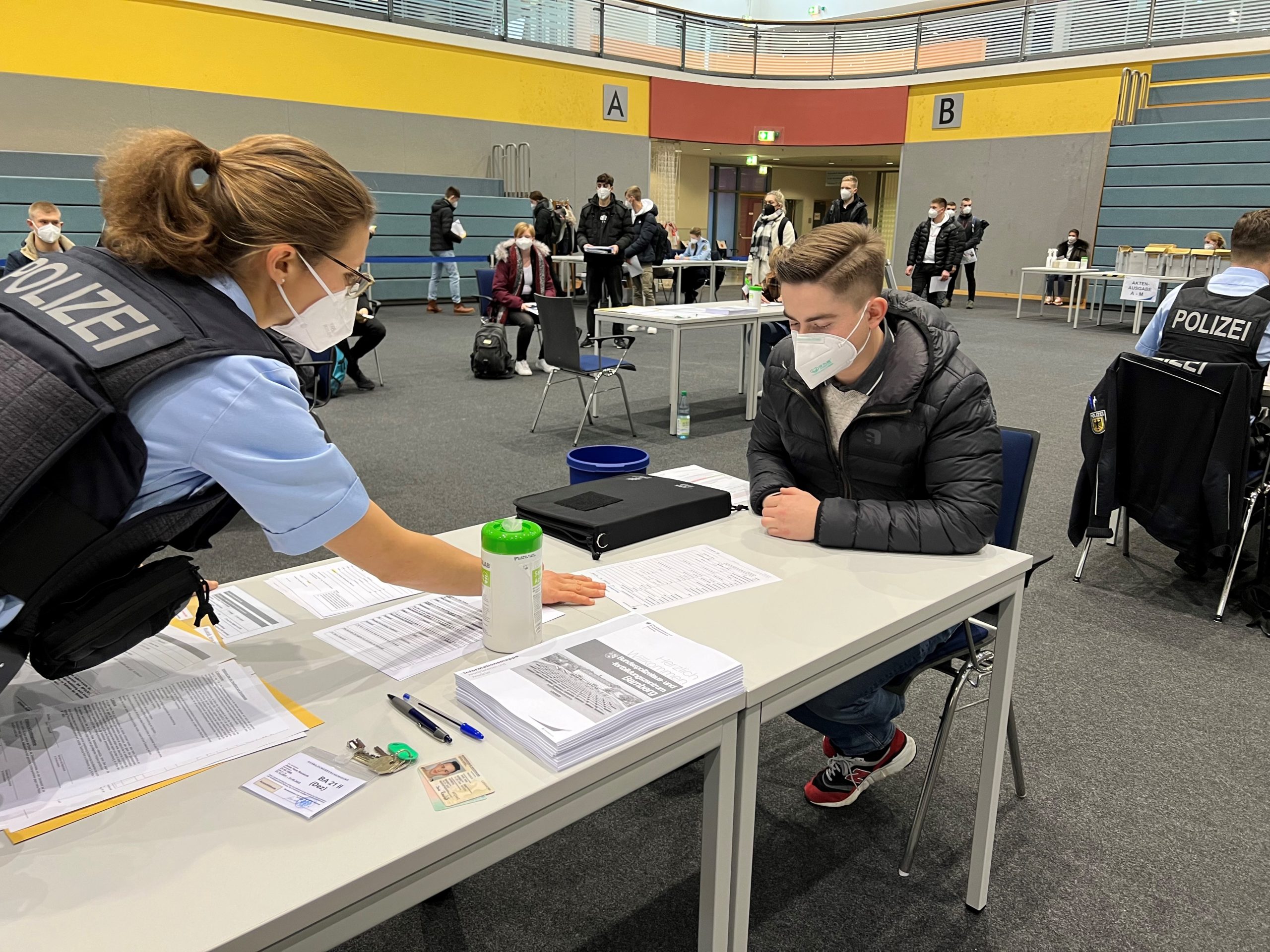Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu unterrichten, ist Ziel eines inklusiven Schulsystems. Eine Studie hat nun jedoch gezeigt: Das Konzept der Schwerpunktschulen kann sich negativ auf das soziale Miteinander der Kinder auswirken.
Kurz vor dem heutigen „Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung“ haben Marcel Helbig und Sebastian Steinmetz, Forscher am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) in Bamberg und am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), eine Studie zu Inklusion und sozialer Integration veröffentlicht. Darin sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das Schulkonzept der Schwerpunktschulen zu Lasten des sozialen Miteinanders auswirkt.
Die Daten ihrer Studie haben Helbig und Steinmetz in in Rheinland-Pfalz erhoben. Dort wird, statt ein breites inklusives Angebote zu machen, bei Inklusion fast ausschließlich auf Schwerpunktschulen gesetzt.
Rheinland-Pfalz setzt als einziges Bundesland bei der Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf fast ausschließlich auf Schwerpunktschulen. Die Mehrheit der Bundesländer hat sich dagegen für eine flächendeckende Inklusion entschieden. In einigen Ländern wie Berlin, Hamburg oder Brandenburg gibt es Mischsysteme aus flächendeckender Inklusion und Schwerpunktschulen.
Der Anteil von Kindern aus einkommensschwachen Familien ist an den inklusiven Schwerpunktschulen in Rheinland-Pfalz seit 2012 überdurchschnittlich gewachsen. Vor allem in den Städten hat sich damit das Problem der sozialen Trennung im Grundschulwesen verschärft.
Die Studie weist nun mit Daten der amtlichen Schulstatistik nach, dass das Konzept der inklusiven Schwerpunktschule auf Kosten der sozialen Integration geht. Das liegt zum einen in der Entstehung dieser Schulen begründet. So wurden in Rheinland-Pfalz die sozial schwächeren Grundschulen als Standorte für Schwerpunktschulen ausgewählt. Dabei handelt es sich um Schulen, die bereits vor ihrer Umwandlung einen hohen Anteil von Kindern aus einkommensschwachen Familien hatten. So lag der Anteil von Kindern mit Lernmittelbefreiung an Schwerpunktschulen sechs Prozentpunkte höher als an Nicht-Schwerpunktschulen.
Inklusiver Unterricht an allen Schulen als Ziel
Seit 2012 hat sich die Armutsquote an den Schwerpunktschulen zum Teil überdurchschnittlich erhöht. Dies gilt vor allem für die städtischen Räume, wo sich der Unterschied beim Anteil armer Kinder zwischen Schwerpunktschulen und Nicht-Schwerpunktschulen auf 12 Prozentpunkte verdoppelte. Dies trifft in besonderem Maße in Nachbarschaften zu, in denen es weitere Grundschulen gibt.
„Wir vermuten” sagt Marcel Helbig, „dass vor allem Eltern aus der Mittelschicht die Schwerpunktschulen meiden und ihre Kinder auf andere Grundschulen in Wohnortnähe schicken.” Schwerpunktschulen in Rheinland-Pfalz müssen daher doppelte Integrationsarbeit leisten, eine pädagogische und eine soziale. „Das geht zu Lasten der Chancengerechtigkeit, verstärkt soziale Trennung und zeigt, dass halbherzige Inklusion nicht-beabsichtigte soziale Folgen haben kann.“
Zusammen mit Sebastian Steinmetz plädiert der Autor der Studie für die Überwindung der Schwerpunktschulen zugunsten eines inklusiven Unterrichts an allen Schulen. Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 wäre Deutschland ohnehin verpflichtet, Kinder und Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam zu unterrichten. Die Konvention sieht vor, dass inklusiver Unterricht in möglichst wohnortnahen Schulen angeboten wird. Schwerpunktschulen konterkarieren dieses Recht aber und verhindern einen systematischen Wandel hin zu einem inklusiven Schulsystem, da nur bestimmte Standorte diesen pädagogischen Auftrag übernehmen.
Rheinland-Pfalz ist neben Bayern und Baden-Württemberg Schlusslicht bei der Umsetzung schulischer Inklusion, wie eine im September 2021 erschienene WZB-Studie gezeigt hat.