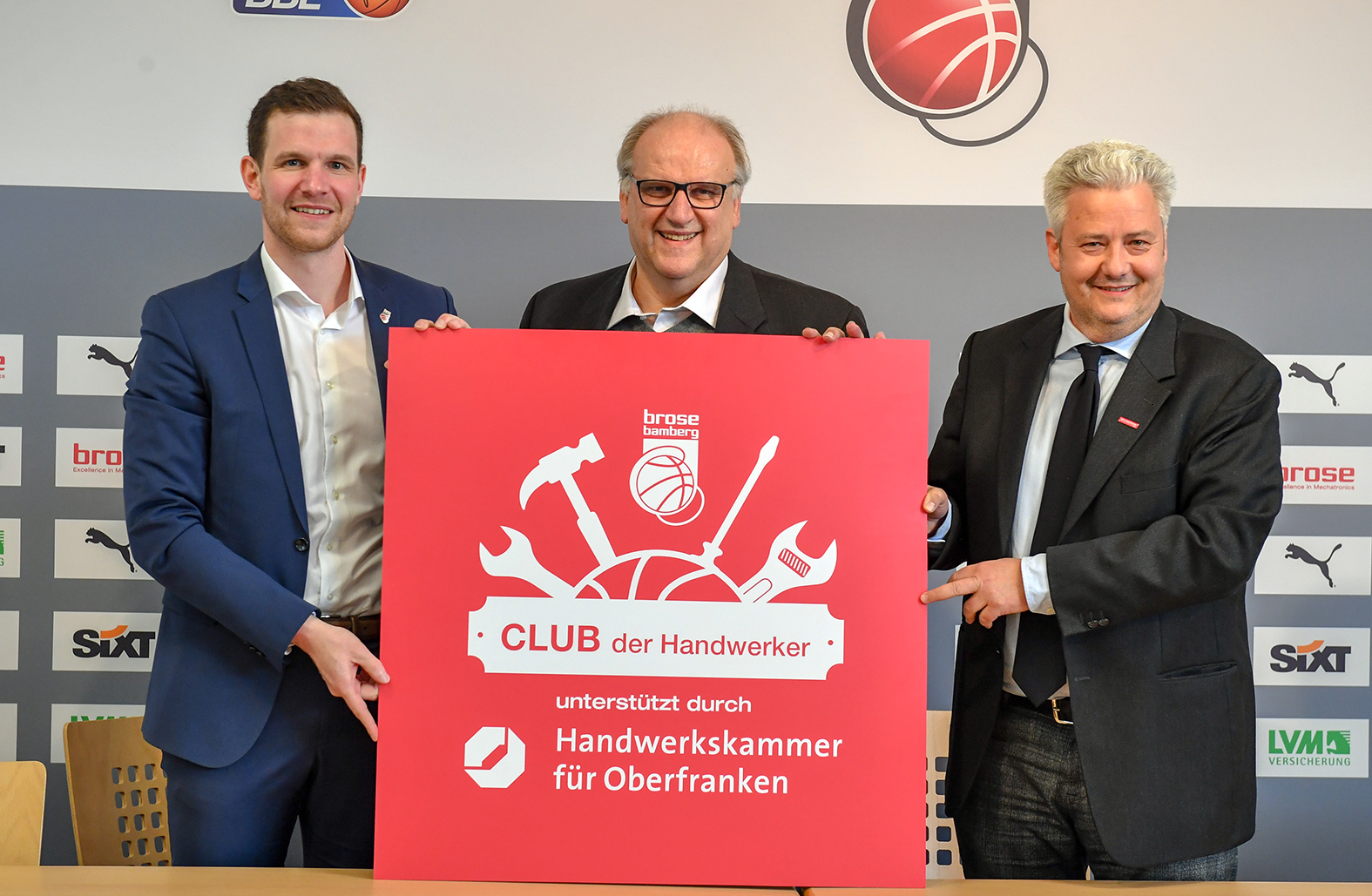HWK für Oberfranken vereidigt Christoph Kramer aus Forchheim
Neuer Sachverständiger für das Holzblasinstrumentenmacherhandwerk
Die Handwerkskammer für Oberfranken bestellt und vereidigt Sachverständige aus verschiedenen Gewerken, um privaten Auftraggebern, aber auch Gerichten und Behörden Fachexperten zur Verfügung zu stellen, deren persönliche Integrität, Fachwissen und Unparteilichkeit gewährleistet ist. Nun wurde mit Christoph Kramer aus Forchheim ein neuer Sachverständiger für das Holzblasinstrumentenmacherhandwerk vereidigt.
Der 33-Jährige ist Meister seines Faches und musste vor der Vereidigung eine juristische Fortbildung ablegen und in einer zusätzlichen Fachprüfung einen echten Praxisfall lösen und dazu ein Gutachten erstellen. Durch die Arbeit der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen besteht die Chance, Streitigkeiten zwischen Handwerkern und Kunden außergerichtlich und damit relativ schnell und kostengünstig zu klären.
Der Weg zum Sachverständigen ist nicht einfach. Bewerber für das Amt werden intensiv überprüft, im Hinblick auf ihre Berufs- und Lebenserfahrung, auf ihre persönliche Eignung und natürlich hinsichtlich ihrer besonderen Sachkunde. Diese Beurteilung übernahm im Auftrag der Handwerkskammer die Innung für Musikinstrumentenbau Nordbayern.
Streitigkeiten außergerichtlich beilegen
Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige im Holzblasinstrumentenmacherhandwerk sind rar. Mit Christoph Kramer gibt es nun deutschlandweit gerade einmal eine Handvoll Sachverständige in diesem Handwerk. Zusammen mit Hauptabteilungsleiter Thomas Rudrof aus der Rechtsabteilung der Kammer und HWK-Geschäftsführer Rainer Beck nahm Präsident Matthias Graßmann die Vereidigung vor und wünschte Christoph Kramer bei seiner neuen Tätigkeit viel Glück, Kraft und Erfolg.
Diese Vereidigung gilt als öffentliche Bestellung im Sinne der Zivil- und Strafprozessordnung. Der Sachverständige ist bei seiner Arbeit nur seinem Gewissen unterworfen und ist in dieser Funktion kein Interessenvertreter des Handwerks. Gemäß der Sachverständigenordnung untersteht jedoch jeder von der Handwerkskammer bestellte Sachverständige auch der Aufsicht der Handwerkskammer. Daher wünscht sich Präsident Matthias Graßmann auch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Wir sind immer gerne bereit, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, so Graßmann.
Eingeschaltet werden die rund 90 Sachverständigen in Oberfranken in aller Regel bei Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten zwischen Handwerkern und Kunden über eine erbrachte Leistung. In vielen Fällen ist schon nach der Einschätzung durch einen Sachverständigen klar, wie ein Streit ausgehen wird. Aufwändige Gerichtsprozesse können so vermieden werden.
Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsverkehrs
HWK fordert: Das Handwerk muss im Verkehrsentwicklungsplan 2030 stärker berücksichtigt werden
Der Präsident der Handwerksammer für Oberfranken, Matthias Graßmann, begrüßt, dass die Stadt Bamberg ihren Bürgerinnen und Bürgern aktuell die Möglichkeit bietet, sich online in die Planungen zur Verkehrsentwicklung aktiv einzubringen. „Die Belange des Handwerks werden im aktuellen Entwurf des VEP 2030 allerdings unzureichend berücksichtigt“, warnt Graßmann. Besonders im Bereich des Wirtschaftsverkehrs bestünde noch Handlungsbedarf.
Matthias Graßmann: „Unsere Mitgliedsbetriebe sind, besonders in der Bamberger Innenstadt, auf gute Erreichbarkeiten angewiesen. Handwerkerinnen und Handwerker müssen in der Lage sein, in Kunden- oder Baustellennähe parken oder halten zu können.“ Graßmann betont, dass das Handwerk die Leitziele des VEP 2030 unterstützt, aber die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dürften nicht ausschließlich zu Lasten der Wirtschaft gehen. Sinnvoll sei beispielsweise das im Plan vorgeschlagene City-Logistik-Konzept, welches die Abstimmung von Lieferzeiten und die Etablierung von Micro-Hubs vorsehe. „Der vermehrte Einsatz von Lastenrädern“, so der Präsident weiter „ist für das Handwerk allerdings wenig zielführend. Das bleibt im Handwerk eine absolute Nische. Wir sind auf eigene Fahrzeuge angewiesen und müssen damit alle unsere Kunden erreichen können.“
In der Gesamtbetrachtung werde der Maßnahmenplan der Bedeutung des Handwerks nicht gerecht und gefährde die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsverkehrs in Bamberg. Fehlende Stellplätze beim Kunden und der zunehmende organisatorische Aufwand bei der Anfahrt zur Baustelle sind die größten verkehrspolitischen Belastungen der Betriebe. „Und der aktuelle Entwurf des VEP zielt leider darauf ab, diese Belastungen sogar noch zu erhöhen.“ Daher fordert Graßmann, dass das Handwerk mindestens als Sondernutzer berücksichtigt werden müsse. „Wenn’s beim Kunden brennt, muss auch das Parken und Halten ortsnah möglich sein. Die Nähe und der direkte Kontakt zum Kunden sind das A und O im Handwerk.“
Rohstoffpreise gefährden Handwerkskonjunktur
Das oberfränkische Handwerk fordert Maßnahmen, um Verwerfungen auf dem Markt für Baumaterialien entgegenzuwirken
Fehlende Materialien und hohe Rohstoffpreise belasten derzeit viele Handwerksbetriebe in Oberfranken. Trotz guter Auftragslage geraten bei Bau- und Ausbaubetrieben Baumaßnahmen ins Stocken. Der Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, warnt deshalb vor möglichen Folgen für die Handwerkskonjunktur.
„Wenn sich an dieser Situation nichts ändert, steht die konjunkturelle Erholung im Handwerk auf dem Spiel. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, in der alle wirtschaftlichen Kräfte für eine Wiederbelebung und den Neustart gebraucht werden, müssen zusätzliche Belastungen aus dem Weg geräumt werden“, äußert Präsident Matthias Graßmann. Die Politik sei daher aufgefordert, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente einzusetzen, um den Verwerfungen auf dem Markt für Baumaterialien entgegenzuwirken und diese in den Griff zu bekommen.
Insbesondere die öffentlichen Auftraggeber hätten hier eine Vorbildfunktion, so Graßmann. Deshalb sei es gut, dass die Bayerische Staatsregierung bereits eine Forderung des Handwerks aufgegriffen hat und nun für einige Materialien bei öffentlichen Aufträgen zeitlich begrenzt vertragliche Stoffpreisgleitklauseln vorsieht. Graßmann fordert weiter: „Zudem darf ein Handwerksbetrieb, der wegen der aktuellen Probleme den Vertrag nicht rechtzeitig erfüllen kann, nicht mit Vertragsstrafen überzogen werden.“
Vor allem die Bau- und Ausbauhandwerker haben sich während der Pandemie als wesentliche Konjunkturstütze erwiesen. „Es ist geradezu widersinnig, dass Handwerksbetriebe bei gefüllten Auftragsbüchern nun plötzlich Kurzarbeit in Betracht ziehen müssen, weil wichtige Materialien fehlen oder die Preise durch die Decke schießen“, so der HWK-Präsident. Es sei daher richtig, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Initiative ergriffen und die akuten Preis- und Beschaffungsprobleme von Rohstoffen und Vorprodukten zur Chefsache erklärt hat. Wichtig sei aber auch, dass das Thema auf EU-Ebene gehoben werde, da die aktuellen Preis- und Beschaffungsprobleme kein rein deutsches Problem sei.
Bayerisches Handwerk schreibt Brief an Ministerpräsident Söder
„Bayern behandelt Handwerksbetriebe weiterhin schlechter“
Die bayerischen Handwerkskammern und Handwerksverbände zeigen sich von den neuerlichen Änderungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und ihrer Umsetzung der Bundesnotbremse in Bayern enttäuscht. In einem Brief an Ministerpräsident Dr. Markus Söder wurde daher Kritik geäußert.
„Nicht nur, dass sich die Hoffnung auf wirklich bundeseinheitliche Regelungen immer noch nicht erfüllt hat“, erklärt der Präsident der Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken, Matthias Graßmann. „Bayern stellt vielmehr seine Handwerksbetriebe weiterhin schlechter als die anderen Bundesländer. Allen voran die Kosmetikbetriebe und Nagelstudios, die im Freistaat – unabhängig von den Inzidenzen – geschlossen sind, obwohl die Bundesnotbremse dies gar nicht vorsieht.“ Daher hat der Bayerische Handwerkstag (BHT), die Spitzenorganisation der bayerischen Handwerkskammern und ‑verbände, einen Brief an Ministerpräsident Dr. Markus Söder geschrieben und deutliche Kritik geäußert.
Forderung nach Angleichung der bayerischen Verordnung an die Bundesnotbremse
Als im Bundesrat die bundeseinheitliche Notbremse gebilligt wurde, „waren wir zuversichtlich, dass nunmehr die Zeit der 16 unterschiedlichen Landesregelungen beendet ist. Gerade das Land Bayern haben wir als einen großen Fürsprecher für eine deutschlandweit einheitliche Regelung wahrgenommen“, heißt es in dem Schreiben, das stellvertretend für das bayerische Handwerk von BHT-Präsident Franz Xaver Peteranderl und BHT-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Hüpers unterzeichnet wurde. Leider seien die Hoffnungen aber enttäuscht worden und für das bayerische Handwerk blieben wesentliche Benachteiligungen weiterhin bestehen.
Diese Aussage stützt der Präsident der HWK für Oberfranken. „Seit Monaten sind gerade die Handwerksbetriebe, die die sogenannten körpernahen Dienstleistungen erbringen – also unsere Kosmetikerinnen, Nagelstudios und Friseure –, besonders heftig von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie betroffen“, sagt Graßmann. „Und werden in Bayern jetzt abermals benachteiligt.“ Das Infektionsschutzgesetz des Bundes und die darin jetzt verankerte Notbremse würden weder die inzidenzunabhängige Schließung von Kosmetikern und Nagelstudios regeln, noch die weitere Beschränkung der Quadratmeterzahl bei Friseuren.
Daher fordert Graßmann gemeinsam mit dem BHT von Ministerpräsident Söder, die bayerischen Regeln an die Bundesnotbremse anzugleichen und sich ferner für eine baldige Öffnung der Kosmetikbetriebe und Nagelstudios einzusetzen.
Matthias Graßmann ist neuer Präsident der HWK für Oberfranken
„Jetzt gemeinsam nach vorne sehen und Herausforderungen geschlossen angehen“
Die Vollversammlung der Handwerkskammer für Oberfranken hat in ihrer Sitzung am Montag die Weichen gestellt und Dipl.-Ing. (FH) Matthias Graßmann aus Bamberg mit deutlicher Mehrheit zum neuen Präsidenten der Handwerkskammer gewählt. Neuer Vizepräsident (Arbeitgeberseite) ist Metzgermeister Christian Herpich aus Hof, neu im Vorstand der Kammer ist Zimmerermeister Günther Stenglein aus Kulmbach.
Graßmann griff in seinem kurzen Statement nach der Wahl das Bild auf, das Ministerialrat Dr. Peter Stein (Bayerisches Wirtschaftsministerium) zuvor gezeichnet hat. „Damit beginnt jetzt ein neuer Zeitabschnitt, ein neues Kapitel der Handwerkskammer“, sagte der neue Präsident. „Dieses wird von Transparenz und Offenheit und von einem fairen Miteinander geprägt sein.“
Der neu gewählte Präsident appellierte an seine Kolleginnen und Kollegen, jetzt gemeinsam nach vorne zu sehen und die Herausforderungen geschlossen anzugehen. „Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen“, zitierte Graßmann Aristoteles. „Jetzt kann die Handwerkskammer wieder das Ganze in den Blick nehmen und die Zukunftsthemen des Handwerks angehen.“ Diese seien, so Graßmann, vor allem die Nachwuchssicherung im Handwerk, die Modernisierung der Schulungszentren der Handwerkskammer, das Thema Unternehmensnachfolge, die Digitalisierung und Innovation sowie die Zusammenarbeit mit den Kreishandwerkerschaften und Innungen in der Region. „Wir haben hier schon vieles begonnen und sind auf gutem Wege.“ Der Präsident skizzierte auch die Vorstellungen, wie sich der nun wieder vollzählige Vorstand das künftige Miteinander in der Vollversammlung und im oberfränkischen Handwerk wünsche. „Wir möchten auch in der Vollversammlung mehr Austausch, mehr Diskussionen, die gerne auch kontrovers sein dürfen – aber bitte immer sachlich bleiben sollten.“
Die Herausforderungen, vor der das oberfränkische Handwerk und auch die Handwerkskammer stehen, sind enorm. Dies machte auch Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz deutlich, die als regelmäßiger Gast auch bei der außerordentlichen Vollversammlung ihre Verbundenheit mit dem Handwerk demonstrierte. Die Corona-Pandemie, deren wirtschaftliche Folgen, der sich deutlich verschärfende Fachkräftemangel – „wir stehen gemeinsam vor großen Herausforderungen, die jetzt mit einer neuen Spitze und neuen Personen angegangen werden.“ Wichtig sei es aber, immer ein menschliches Miteinander und einen fairen Umgang zu pflegen. Piwernetz dankte in ihrem Grußwort dem Handwerk, aber auch ausdrücklich der Kammer und ihren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Sie haben uns in der Corona-Pandemie vorbildlich unterstützt.“
Ministerialrat Dr. Stein stellte in seinem Grußwort zum Ende der Vollversammlung noch gute Nachrichten für die Handwerkskammer und für das oberfränkische Handwerk in Aussicht. „Die Handwerkskammer bekommt voraussichtlich die Kosten, die die Teststrategie für die Bildungseinrichtungen (verpflichtendes Testen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den ÜLU- und Qualifizierungsmaßnahmen) mit sich bringt, aus Mitteln der Handwerksförderung ersetzt“, gab er bekannt. Der Freistaat Bayern werde zudem seinen Beitrag für die Modernisierung der Schulungszentren der Handwerkskammer leisten, versprach der Ministerialrat. Dr. Stein, der im Wirtschaftsministerium für die Handwerkskammer zuständig ist, bescheinigte der Kammer gute Arbeit. „Die Dreiheit aus Freistaat bzw. Wirtschaftsministerium, Regierung von Oberfranken und Handwerkskammer funktioniert sehr gut, wir arbeiten hervorragend mit den Verantwortlichen zusammen.“
Deutliche Ergebnisse für die Kandidaten
Bei der Wahl zum Präsidenten, die Ministerialrat Dr. Peter Stein leitete, blieb Matthias Graßmann, der vom Vorstand für das Amt des Präsidenten vorgeschlagen wurde, der einzige Kandidat. Und auch die Vorschläge für den durch die Wahl Graßmanns freiwerdenden Posten als Vizepräsident für die Arbeitgeberseite und den nicht besetzten Vorstandsposten wurden seitens der Vollversammlung akzeptiert. So erreichten alle drei Kandidaten hervorragende Ergebnisse: Matthias Graßmann wurde mit 36 von 40 Stimmen zum Präsidenten gewählt, Christian Herpich mit 38 Ja-Stimmen zum Vizepräsidenten und Günther Stenglein mit 39 Stimmen in den Vorstand gewählt. Herpich ist zuvor von seinem Amt als Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Hochfranken zurückgetreten, da die Satzung der HWK festschreibt, dass weder der Präsident noch die Vizepräsidenten diese Funktion innehaben dürfen. Auch das Amt des Obermeisters der Fleischer-Innung Hof-Wunsiedel legt Herpich nieder. In den Rechnungsprüfungsausschuss rückte Hannes Müssel (Marktredwitz) nach, dessen Vorsitz übernahm Mathias Söllner aus Lichtenfels für Günther Stenglein.
Handwerkskammern und Bayerischer Handwerkstag kritisieren Testpflicht
„Misstrauensvotum der Politik“
Die bayerischen Handwerkskammern und der Bayerische Handwerkstag halten die Bundesregelung der Testpflicht für unnötig. Schon heute würden zahlreiche Handwerksbetriebe in Oberfranken die Selbstverpflichtung der Wirtschaft umsetzen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig Test-Angebote machen. Die Handwerkskammer für Oberfranken sieht in der Testpflicht eine weitere finanzielle und bürokratische Belastung für die Betriebe.
Die Handwerkskammer für Oberfranken kritisiert die Testpflicht für Betriebe gemeinsam mit den anderen bayerischen Kammern und dem Bayerischen Handwerkstag (BHT) als „Misstrauensvotum der Bundesregierung gegenüber den Betrieben und ihren Beschäftigten“. Schon heute würden zahlreiche Handwerksbetriebe in Oberfranken die Selbstverpflichtung der Wirtschaft umsetzen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig Test-Angebote machen. Zugleich gebe es bei den kleinen und mittleren Betrieben des Handwerks bereits ausgeklügelte Hygienekonzepte im Kampf gegen das Virus.
Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am 13. April neben dem „Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ auch die Änderung der SARS-Covid-2-Arbeitschutzverordnung beschlossen. Damit wird es für Arbeitgeber die Verpflichtung geben, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht ausschließlich im Home-Office arbeiten, mindestens einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten. Beschäftigtengruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko müssen die Möglichkeit bekommen, sich zweimal pro Woche zu testen. „Das bedeutet eine weitere finanzielle und bürokratische Belastung für unsere Betriebe“, bewertet der Geschäftsführer der Handwerkskammer für Oberfranken, Dr. Bernd Sauer, die Testpflicht. „Wir halten diese gesetzliche Verpflichtung nicht für notwendig und für nicht für sinnvoll.“
Handwerkskammer mit Selbsttests für Mitarbeiter*innen
Der Geschäftsführer und der Vizepräsident der Handwerkskammer für Oberfranken, Matthias Graßmann, stimmen mit ihren Kollegen der anderen bayerischen Kammern und des Bayerischen Handwerkstag (BHT) auch überein, dass diese gesetzliche Pflicht „ein Misstrauensvotum der Bundesregierung gegenüber den Betrieben und ihren Beschäftigten“ ist. Schon heute würden zahlreiche Handwerksbetriebe in Oberfranken die Selbstverpflichtung der Wirtschaft umsetzen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig Test-Angebote machen. Zugleich gebe es bei den kleinen und mittleren Betrieben des Handwerks bereits ausgeklügelte Hygienekonzepte im Kampf gegen das Virus. Der Geschäftsführer: „Schließlich ist es auch im Interesse jedes Betriebsinhabers, dass seine Fachkräfte und auch seine Kunden gesund bleiben.“
Daneben sei die Testpflicht eine weitere bürokratische und finanzielle Belastung, zumal die Kosten alleine bei den Betrieben hängen bleiben. „Das ist das Gegenteil dessen, was unsere ohnehin schon stark belasteten Betriebe jetzt brauchen“, betont Sauer. „Wir empfinden dies ein Stück weit auch als Versuch, die beim Staat liegende Verantwortung für die Pandemiebekämpfung auf die Wirtschaft zu verlagern. Wir brauchen in dieser Situation allerdings nicht diese, damit einhergehende Misstrauenskultur, sondern einen Schulterschluss!“
Die Handwerkskammer für Oberfranken stellt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übrigens schon seit dem 1. April pro Woche einen Selbsttest zur Verfügung. „Damit kann jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, der diesen Test für sich machen will, dies auch tun.“
Handwerkskammer für Oberfranken appelliert für Corona-Tests in Handwerksbetrieben
„Regelmäßiges Testen schmälert die Gefahr einer erneuten Lockdown-Verschärfung“
Regelmäßige Corona-Tests können die Gefahr einer erneuten Lockdown-Verschärfung verringern. Die Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken appelliert daher an ihre rund 16.400 Mitgliedsbetriebe, Beschäftigten vermehrt Selbsttests anzubieten.
„Dies ist im Interesse aller, um Infektionen frühzeitig zu entdecken und Infektionsketten entsprechend durchbrechen zu können“, sagt der Vizepräsident der HWK für Oberfranken, Matthias Graßmann. Eine generelle Testpflicht, die mit zusätzlichen bürokratischen Belastungen für Unternehmen verbunden wäre, lehnt die Handwerkskammer ebenso wie die anderen bayerischen Kammern allerdings strikt ab.
Wer trägt die Kosten?
„Durch regelmäßiges Testen und die Einhaltung der Hygieneregeln kann die Zeit überbrückt werden, bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann“, betont Graßmann weiter. Zwar bestehe aktuell weder für Betriebe noch für Beschäftigte eine Testpflicht: „Es ist jedoch im Interesse von uns allen, dass sowohl Unternehmerinnen und Unternehmer als auch ihre Beschäftigten gesund bleiben. Eine leistungsstarke und gesunde Belegschaft ist die maßgebliche Voraussetzung für einen funktionierenden Betrieb ohne Produktionsausfälle.“
Außerdem könnten regelmäßige Tests dazu beitragen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. „Dies wiederum schmälert die Gefahr einer erneuten Lockdown-Verschärfung“, sagt Graßmann. Allerdings fordert das Handwerk auch. „Damit unsere Betriebe in Oberfranken und auch in ganz Bayern großflächig testen können, müssen die erforderlichen Tests aber auch vorhanden sein. Hier muss die Politik ihre Hausaufgaben machen und für die entsprechenden Kapazitäten sorgen.“ Zudem stelle sich natürlich die Frage, wer letztlich für die Kosten der Betriebe aufkomme, wenn auf der anderen Seite alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos getestet werden. Dennoch rät der HWK-Vizepräsident seinen Handwerkskollegen, möglichst viel zu testen. „Wir tragen so unseren Teil dazu bei, weitere beschränkende Maßnahmen zu verhindern.“
Die Handwerkskammer für Oberfranken hat auf der Webseite https://www.hwk-oberfranken.de/corona-schnelltest die wichtigsten Fragen und Antworten für Betriebe zusammengestellt.