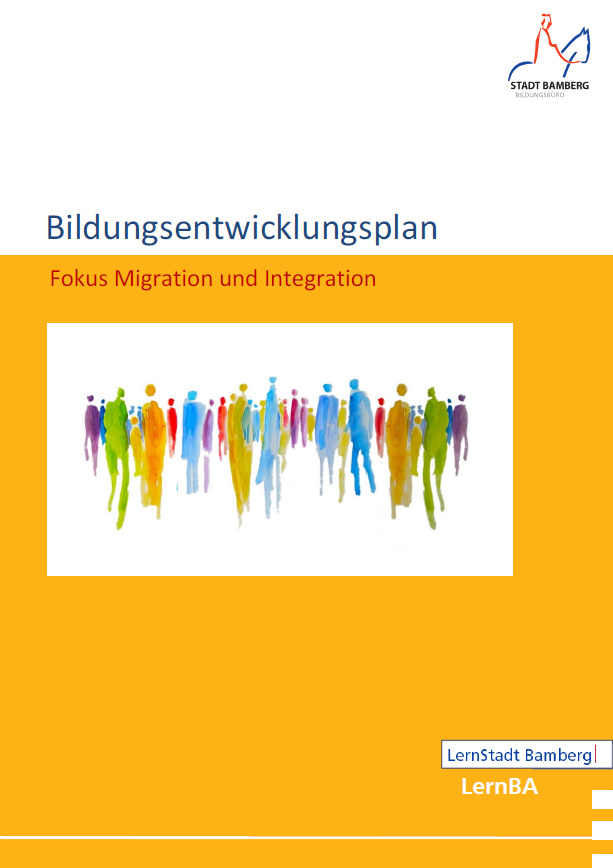Studie
Inklusion kann auf Kosten sozialer Integration gehen
Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu unterrichten, ist Ziel eines inklusiven Schulsystems. Eine Studie hat nun jedoch gezeigt: Das Konzept der Schwerpunktschulen kann sich negativ auf das soziale Miteinander der Kinder auswirken.
Kurz vor dem heutigen „Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung“ haben Marcel Helbig und Sebastian Steinmetz, Forscher am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) in Bamberg und am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), eine Studie zu Inklusion und sozialer Integration veröffentlicht. Darin sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das Schulkonzept der Schwerpunktschulen zu Lasten des sozialen Miteinanders auswirkt.
Die Daten ihrer Studie haben Helbig und Steinmetz in in Rheinland-Pfalz erhoben. Dort wird, statt ein breites inklusives Angebote zu machen, bei Inklusion fast ausschließlich auf Schwerpunktschulen gesetzt.
Rheinland-Pfalz setzt als einziges Bundesland bei der Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf fast ausschließlich auf Schwerpunktschulen. Die Mehrheit der Bundesländer hat sich dagegen für eine flächendeckende Inklusion entschieden. In einigen Ländern wie Berlin, Hamburg oder Brandenburg gibt es Mischsysteme aus flächendeckender Inklusion und Schwerpunktschulen.
Der Anteil von Kindern aus einkommensschwachen Familien ist an den inklusiven Schwerpunktschulen in Rheinland-Pfalz seit 2012 überdurchschnittlich gewachsen. Vor allem in den Städten hat sich damit das Problem der sozialen Trennung im Grundschulwesen verschärft.
Die Studie weist nun mit Daten der amtlichen Schulstatistik nach, dass das Konzept der inklusiven Schwerpunktschule auf Kosten der sozialen Integration geht. Das liegt zum einen in der Entstehung dieser Schulen begründet. So wurden in Rheinland-Pfalz die sozial schwächeren Grundschulen als Standorte für Schwerpunktschulen ausgewählt. Dabei handelt es sich um Schulen, die bereits vor ihrer Umwandlung einen hohen Anteil von Kindern aus einkommensschwachen Familien hatten. So lag der Anteil von Kindern mit Lernmittelbefreiung an Schwerpunktschulen sechs Prozentpunkte höher als an Nicht-Schwerpunktschulen.
Inklusiver Unterricht an allen Schulen als Ziel
Seit 2012 hat sich die Armutsquote an den Schwerpunktschulen zum Teil überdurchschnittlich erhöht. Dies gilt vor allem für die städtischen Räume, wo sich der Unterschied beim Anteil armer Kinder zwischen Schwerpunktschulen und Nicht-Schwerpunktschulen auf 12 Prozentpunkte verdoppelte. Dies trifft in besonderem Maße in Nachbarschaften zu, in denen es weitere Grundschulen gibt.
„Wir vermuten” sagt Marcel Helbig, „dass vor allem Eltern aus der Mittelschicht die Schwerpunktschulen meiden und ihre Kinder auf andere Grundschulen in Wohnortnähe schicken.” Schwerpunktschulen in Rheinland-Pfalz müssen daher doppelte Integrationsarbeit leisten, eine pädagogische und eine soziale. „Das geht zu Lasten der Chancengerechtigkeit, verstärkt soziale Trennung und zeigt, dass halbherzige Inklusion nicht-beabsichtigte soziale Folgen haben kann.“
Zusammen mit Sebastian Steinmetz plädiert der Autor der Studie für die Überwindung der Schwerpunktschulen zugunsten eines inklusiven Unterrichts an allen Schulen. Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 wäre Deutschland ohnehin verpflichtet, Kinder und Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam zu unterrichten. Die Konvention sieht vor, dass inklusiver Unterricht in möglichst wohnortnahen Schulen angeboten wird. Schwerpunktschulen konterkarieren dieses Recht aber und verhindern einen systematischen Wandel hin zu einem inklusiven Schulsystem, da nur bestimmte Standorte diesen pädagogischen Auftrag übernehmen.
Rheinland-Pfalz ist neben Bayern und Baden-Württemberg Schlusslicht bei der Umsetzung schulischer Inklusion, wie eine im September 2021 erschienene WZB-Studie gezeigt hat.
Das könnte Sie auch interessieren...
goolkids beruft seine ersten Botschafter
Inklusion in die Öffentlichkeit tragen
Auf der Bühne, im Sport und in der Politik sind sie in unterschiedlichen Farben unterwegs, beim Förderkreis goolkids sind sie alle in der Sache und auch in der Farbe der Poloshirts vereint. Das hoffnungsfrohe Grün tragen die Botschafterinnen und Botschafter, die seit wenigen Wochen goolkids vertreten.
Landtagsabgeordnete Melanie Huml und Bundestagsabgeordneter Andreas Schwarz, Daniela Kicker, mehrfache Weltmeisterin im Kegeln, und Triathlet Chris Dels, dazu die Brüder Jonas und David Ochs von der Rap-Combo „Bambägga“. Eine illustre Runde hat der Förderkreis goolkids auserkoren.
Mit Interesse und Freude hat Staatsministerin Melanie Huml die Entwicklung von goolkids in den vergangenen Jahren verfolgt. „Der Förderverein hat in den letzten Jahren tolle Aktionen gestartet und viel bewegt. Ich finde goolkids großartig, denn es ist wichtig, dass wir Kindern unabhängig ihrer Herkunft und Fähigkeiten eine chancenreiche Zukunft ermöglichen“, so die Bamberger Landtagsabgeordnete.
„Kinder sind das höchste Gut im Leben. Deshalb brauchen sie erhöhte Aufmerksamkeit und den Umgang mit anderen Kindern“, betont Daniela Kicker. „Eine gute Basis ist dabei gemeinsamer Sport mit Integration aller Kulturen und unterschiedlichen Hautfarben.“ Im Laufe dieses Jahres haben die goolkids-Verantwortlichen erkannt, dass ihre Aktivitäten für Sport-Inklusion auch starke Fürsprecher von außen brauchen.

Ein starker Kerl mit goolkids-T-Shirt
Ausnahmslos alle Anfragen seien innerhalb weniger Stunden mit großer Begeisterung positiv beantwortet worden, betont Robert Bartsch, Initiator von goolkids, „fast so, als wenn unsere sechs Botschafter nur darauf gewartet hätten, mitmachen zu dürfen.“
„Ich freue mich sehr, dass ich nun auch mal etwas zurückgeben kann“, äußert sich Chris Dels dazu, was es für ihn bedeutet, jetzt Inklusions-Botschafter zu sein.
Von goolkids sei ihm als erstes das Auto in seiner Nachbarschaft aufgefallen, „dann ein starker Kerl mit T‑Shirt, der immer mehr Gewichte als ich im Fitness-Studio bewegt hat.“ Auf der Sportgala hielt Dels dann eine Laudatio auf Franz Bezold und betont, dass er bei dieser Veranstaltung schließlich so richtig realisiert habe, wieviel durch goolkids bewegt wird.
Seit zwei Jahren gibt es bei goolkids den Lauf- und Rolltreff, zu dessen Einführung unter anderem Chris Dels einer der Begleiter war. Seitdem ist er oft hautnah dabei und auch stets im Kontakt mit Robert Bartsch und nimmt somit die Entwicklung bei goolkids wahr.
David Ochs und Jonas Ochs sind Brüder und zwei Mitglieder des Rap-Trios „Bambägga“. Beide arbeiten sie bei der Lebenshilfe und sind von daher seit langem mit der Thematik Inklusion vertraut. Bei der Sportgala waren sie in den vergangenen Jahren immer wieder einmal vertreten, unterstützt teilweise von Lebenshilfe-Mitarbeitern. Die beiden freuen sich über die Aufgabe als Inklusions-Botschafter und wollen sich auch weiterhin aktiv für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung einsetzen. „Jeder hat das Recht darauf, dabei zu sein. Auf dem Sportplatz, der Bühne oder im Büro. Inklusion betrifft uns alle und wird besonders gut, wenn möglichst viele mitmachen.“
Dass noch viele mitmachen und mithelfen, ist auch eine Hoffnung von Initiator Bartsch. Und dass durch das Engagement der Botschafter andere, interessierte Menschen sehen, dass sie als Ehrenamtliche, Helfer oder Begleiter die Arbeit bei goolkids mitgestalten können.
„Das Thema in die Öffentlichkeit tragen“
In die gleiche Kerbe schlägt Andreas Schwarz, der auch beim ersten goolkids-Schnuppertag vor Ort war: „Um Inklusion in unsere Gesellschaft hineinzubringen, benötigt es viele kleine Schritte und viele helfende Hände. Der Förderverein goolkids leistet hier einen großartigen Beitrag für die Region Bamberg. Ich bin sehr stolz, Inklusions-Botschafter für goolkids zu sein.“

Ebenso stolz war Daniela Kicker davon, als Inklusions-Botschafter angefragt worden zu sein. „Vor einigen Jahren ist mir goolkids in den Medien erstmals aufgefallen. Das soziale Engagement hat mich damals schon beeindruckt.“ Die mehrfache Deutsche Meisterin und Champions League-Siegerin im Kegeln betont, dass sie sich auf die bevorstehenden Aufgaben freue, „weil ich gerne mit Kindern arbeite und darüber hinaus auch meine Erfahrungen aus über 30 Jahren in verschiedenen Klubs einbringen kann, mit Migranten, ausländischen Sportlern und behinderten Menschen. Die Integration dieser Menschen, andere Kulturen kennenzulernen und zu respektieren, ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, an der ich mich gerne beteilige.“
Robert Bartsch sieht ein breites Feld an Möglichkeiten, wie die Botschafterinnen und Botschafter den Förderkreis vertreten können. Seien es die Besuche der goolkids-Aktivitäten oder auch, indem sie eigene Aktivitäten umsetzen, durch die sie auch auf das Thema Inklusion aufmerksam machen. Wie er weiter berichtet, wurden schon von allen Botschaftern eigene Ideen eingebracht wurden, deren Umsetzungsmöglichkeiten gemeinsam näher besprochen werden.
„Wichtig ist einfach, dass wir zusammen zeigen, wie leicht Inklusion gemeinsam sein kann. Natürlich erhoffen wir durch deren Einsatz auch eine Stärkung unseres Ehrenamtes und viele begeisterte Neueinsteiger für unseren Weg. Inklusion bedeutet ja auch offene Teilhabe – warum also dies nicht auch mit den Machern und Botschaftern gemeinsam so umsetzen?“

Auch Melanie Huml sieht mit Freude, wie es dem Förderkreis gelingt, Menschen zusammen zu bringen. „Während wir uns im Alltag häufig in einem immer ähnlichen Umfeld bewegen, schafft goolkids Chancen für neue Begegnungen. Gerade gemeinsame Sportaktivitäten sind dafür ideal, denn hier zählen vor allem Einsatzfreude und Teamgeist.“
Ein großes Projekt, auf das die Botschafterinnen und Botschafter gemeinsam mit goolkids hinarbeiten, ist, dass die Bewerbung der Region Bamberg als „Host-Town 2023“ erfolgreich ist. Die Special Olympics World Games finden 2023 in Berlin und damit erstmals in Deutschland statt. Die Stadt Bamberg hat sich hierfür als Host Town beworben, sprich als eine der insgesamt 170 Städte, die im Vorfeld für jeweils ein Teilnehmerland Gastgeberstadt sind, bevor alle Delegationen fünf Tage vor Beginn der Spiele nach Berlin zu den Wettkämpfen weiterreisen. „Dies kann ein sehr bedeutsamer Schritt sein, um aus Bamberg eine vorbildliche Region für offene Teilhabe beziehungsweise Partizipation zu machen“, so Robert Bartsch.
Er spürt bei allen Botschaftern den Glauben, dass langfristig durch das Engagement eines jeden einzelnen Menschen die Vision einer gelebten inklusiven Gesellschaft Realität werden kann.
Arno Schimmelpfennig produzierte für goolkids im Rahmen der Bewerbung Bambergs als Host Town einen Film, in dem die Botschafter zu Wort kommen, der unter https://fb.watch/8LRI-WvP9S/ angesehen werden kann.
Das könnte Sie auch interessieren...
Förderkreis goolkids
Inklusiver Lauftreff startet wieder
Nach langer Pause lädt der Förderkreis goolkids alle Interessierten am kommenden Samstag, am 18. September, erstmals wieder zum inklusiven Lauf-und Rolltreff in Bamberg ein.
Vor knapp zwei Jahren wurde der Lauftreff ins Leben gerufen mit dem Ziel, regelmäßig stattzufinden. Corona hat allerdings diesen Versuchen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Konnte im Februar vergangenen Jahres der MITeinander-Cup, das beliebte Turnier für Inklusion und Integration als ein buntes Fest mit Fußball, Rollstuhlbasketball und vielen Begegnungen, noch sein fünfjähriges Jubiläum feiern, mussten im Anschluss auch die von goolkids angedachten Aktivitäten ausfallen. Einzig das Benefiz-Golfturnier konnte im Herbst, unter strikten Hygienebedingungen, durchgeführt werden.
Der Förderkreis reagierte flexibel, rief für mobil eingeschränkte Mitbürger und Risikopatienten den Lieferservice „goolkids hilft“ ins Leben, und verlagerte ansonsten seinen Schwerpunkt in den vergangenen fünfzehn Monaten auf sportliche Aktivitäten, die in Form von virtuellen Treffen ausgeübt werden konnten. Zum Beispiel entstand die Idee, unter dem Motto #machMITtwoch jeden Mittwoch ein Video auf Instagram zu posten, das Anregungen zu Sport und Bewegung bietet.
Wie andernorts kehrt auch bei goolkids nun der Optimismus zurück, eine gewisse Form der Normalität möge einkehren. Am 24. Juli wurde der 1. Schnuppertag „Fußball inklusiv“ durchgeführt, eine Möglichkeit, ein inklusives und integratives Kennenlernen des Förderkreises in Selbsterfahrung mit einem Kennen-lern-Training und einem inklusiven Fußballturnier zu ermöglichen.
Lauftreff reloaded
Und am 18. September darf erstmals in diesem Jahr wieder gelaufen werden, goolkids lädt zum inklusiven Lauf- und Rolltreff ein.
„Egal ob Hobbyläufer, Rollstuhlfahrer, Walkingfreunde, Leistungssportler oder Eltern mit ihren Kindern, Menschen mit und ohne Handicap, alle sind herzlich eingeladen und willkommen, dabei zu sein“, betont Robert Bartsch, der goolkids-Initiator.
Alle BambergerInnen sind zur Teilnahme aufgerufen, Treffpunkt ist am Bootshaus im Hain, Beginn um 10 Uhr. „Wir laufen alle miteinander, füreinander, nebeneinander. Und wer nicht laufen kann oder möchte, der darf sich gerne schieben lassen. Die Strecke beträgt drei entspannte Kilometer, kann aber auch gerne mehrfach gelaufen werden“, so Herr Bartsch.
Im Vordergrund stehen der gemeinsame Spaß, das Rollen und Laufen in der Gruppe mit gemütlichem Beisammensein. Der Lauf soll zeigen, dass es sehr einfach und ohne Leistungsdruck gelingt, vielfältig veranlagte Menschen zusammenzubringen. „Wir wollen diese neue Form des Lauftreffs nach und nach mit anderen Laufgruppen ausbauen und in unserer Region etablieren“, so Bartsch weiter.
Es geht an diesem Tag insbesondere darum, allen Menschen zu zeigen, dass es sehr leicht ist, scheinbare Hürden gemeinsam abzubauen. Deshalb ist der gemeinsame Ausklang auf dem Parkplatz beim Bootshaus genauso belebend wie der Lauf selbst.
Leitfaden für inklusiven Sport in Bamberg und der Region
Angetreten vor ziemlich genau sechs Jahren mit dem Slogan „Fußball baut Brücken“ und der Intention, sozial benachteiligte Kinder zu integrieren und zu unterstützen, stellte goolkids über die letzten Jahre hinweg zahlreiche Projekte auf die Beine. Angefangen vom Menschenkicker über den MITeinander-Cup als kleines, aber feines Turnier, die dem Sport treiben miteinander dienen, bis hin zur Sportgala als großer Baustein zur finanziellen Unterstützung, ist das Paket an Aktionen und Veranstaltungen sukzessive gewachsen.
In Kooperation mit LinaS („Lingen integriert natürlich alle Sportler“) entstand als eigenes Inklusionsprojekt ginaS („goolkids integriert natürlich alle Sportler“), unter dem nun die sportlichen Aktivitäten gebündelt sind. Danach entstanden dann viele weitere gute Kooperationen, wie beispielsweise mit der Lebenshilfe Bamberg. Nicht nur im Fußball findet bei ginaS Begegnung statt, sondern unterschiedliche Sportarten, wie Rollstuhlbasketball, Kinderyoga, IntegraFIT oder „TAKT-VOLL – der inklusive Tanztreff“, dienen dem Miteinander.
„Die Möglichkeiten, Inklusion und Integration im Sport zu vereinen, sind dabei unbegrenzt und in fast jeder Sportart möglich“, betont Robert Bartsch. Um allen Interessierten, egal welchen Alters und welcher Herkunft, einen Überblick zu geben, haben die goolkids-Verantwortlichen in den vergangenen Monaten Sportarten und Sportvereine zusammengetragen, in denen barrierefreier Sport möglich ist, und im Juli als kompakte Zusammenfassung einen Leitfaden herausgegeben. In dieser Broschüre, die auch arabische, persische, kurdische und russische Übersetzungen umfasst, sind erstmals alle Sportarten zu finden, die heute schon vorurteilsfrei inklusiv möglich sind.
Ob „Aikido“, „Blinden-Tischtennis“ oder „Minigolf“ – der Leitfaden zeigt kompakt das sportliche Angebot und den für den jeweiligen Sportler passenden Verein. goolkids bietet darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, Vereine auf dem Weg zum inklusiven Sport unterstützen.
Der Leitfaden ist in der Stadt und im Landkreis in gedruckter Form zu finden, als pdf – auch zum Vorlesen – unter www.sport-inklusion.de.
„Inklusion ist für mich, wenn alle zusammen mitmachen dürfen. Dieses neue Werk soll mithelfen, inklusive Sportarten mit Menschen und Vereinen zusammen zu bringen“, bringt Robert Bartsch es auf den Punkt.
Lauf-und Rolltreff
Samstag, 18. September, ab 10 Uhr
Treffpunkt: Bootshaus im Hain
Das könnte Sie auch interessieren...
Geflüchtetenstudie ReGES zieht nach fünf Jahren Bilanz
Befunde zur Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher in das deutsche Bildungssystem
Die Studie ReGES – Refugees in the German Educational System hat über 4.800 geflüchtete Kinder und Jugendliche über einen längeren Zeitraum hinweg begleitet und untersucht, wie gut die Integration in das deutsche Bildungssystem gelingt. Ein Transferbericht fasst nun zentrale Befunde zur Betreuung geflüchteter Kinder in Kindertageseinrichtungen und zur Beschulung geflüchteter Jugendlicher zusammen.
Die Auswertungen der erhobenen Daten zeigen, dass die Integration in verschiedenen Bildungsbereichen durchaus gelingt, aber sie geben auch Hinweise auf Unterstützungsbedarfe und Herausforderungen. Besonders der Sprachförderung kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.
ReGES ist eine Längsschnittstudie, die über 4.800 Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund begleitet. Sie ist im Juli 2016 am Bamberger Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) gestartet und wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Zum Abschluss des Projekts ReGES wurden nun die Analysen verschiedener Forscherinnen und Forscher in einem Transferbericht zusammengefasst. Dieser bietet einen umfangreichen Überblick über bisherige Befunde und zeichnet dabei ein differenziertes Bild über die Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen an verschiedenen Punkten im deutschen Bildungssystem. Die Befunde reichen in ihren Implikationen deutlich über den formalen Bildungsbereich hinaus.
Geflüchtete Kinder deutlich seltener in Kindertageseinrichtungen betreut
Im Rahmen der Studie wurden 2.405 Kinder im Alter von mindestens vier Jahren, die zum ersten Befragungszeitpunkt noch nicht eingeschult waren, und ihre Eltern befragt. 79,2 % der Kinder besuchten eine Kindertageseinrichtung. Die Besuchsquote der untersuchten Geflüchteten bleibt deutlich hinter der anderer Gruppen Gleichaltriger zurück. Dabei erachten Dr. Jutta von Maurice und Dr. Gisela Will, die beiden Verfasserinnen des Transferberichts, den Besuch einer Kindertageseinrichtung gerade für Kinder mit Fluchthintergrund als sinnvoll und wichtig. Die Familien, deren Kinder keine Kindertageseinrichtung besuchten, gaben als Grund hierfür am häufigsten an, dass kein Betreuungsplatz verfügbar war. Die Problemlage von Geflüchteten geht aber darüber hinaus, so die Autorinnen des Transferberichts, da etwa einige Eltern hier von fehlenden Informationen berichten.
„Ein erfreuliches Ergebnis ist, dass 94,1 % der befragten Erzieherinnen und Erzieher die Integration der Kinder mit Fluchthintergrund in ihrer Einrichtung als gelungen einschätzen“, so Jutta von Maurice, Leiterin der ReGES-Studie. Es dürfe aber nicht unerwähnt bleiben, dass damit 5,9 % nicht von einer gelingenden Integration berichten.
Deutsche Sprache als Schlüsselkompetenz
Im Rahmen der Studie wurden 2.415 geflüchtete Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren dazu befragt, wie sie ihre sprachlichen Fähigkeiten im Allgemeinen (Verstehen, Sprechen, Lesen, Schreiben) und mit Bezug auf spezielle Anwendungsfälle einschätzen. Die erhobenen Daten weisen auf deutliche Kompetenzunterschiede in Alltags- und Bildungssprache hin.
Während die befragten Jugendlichen ihre Fähigkeiten im Allgemeinen häufig als „eher gut“ oder sogar „sehr gut“ einschätzen, zeigt die differenzierte Erhebung ein deutlich komplexeres Bild: So können 93,0 % jemanden begrüßen oder sich vorstellen, aber nur 41,1 % können den meisten Fernsehsendungen problemlos folgen. Und schließlich können nur 18,7 % Literatur und Sachbücher lesen und 15,2 % nach eigenen Angaben anspruchsvolle Texte schreiben. „Die Befunde zur Sprachkompetenz weisen sehr deutlich auf die Notwendigkeit von Sprachfördermaßnahmen hin. Hier alarmiert der Befund, dass 64,9 % der Jugendlichen zum Erhebungszeitpunkt an keiner Maßnahme zur Förderung der Deutschkompetenzen teilnahmen“, so Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach, ehemaliger Direktor des Bamberger Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe und einer der Antragsstellenden der Studie. Er fordert daher den Ausbau von Angeboten der schulischen und außerschulischen Sprachförderung.
Große Herausforderungen in den Schullaufbahnen geflüchteter Jugendlicher
Die befragten Jugendlichen gaben im Rahmen der Studie Auskunft zum Schulbesuch vor, während und nach ihrer Flucht. „Die Daten zeigen unter anderem, dass die Schullaufbahn der befragten Jugendlichen aufgrund der Flucht und im Zuge des Ankommens in Deutschland durchschnittlich länger als ein Jahr unterbrochen war“, so Gisela Will. Die anschließende Beschulung in Deutschland erfolge überdies häufig in niedrigeren – dem Alter der Jugendlichen nicht entsprechenden – Klassenstufen. Gisela Will, Projektkoordinatorin der Studie ReGES, betont, dass man mögliche Kumulationen der Risiken in den Bildungswegen geflüchteter Jugendlicher im Blick behalten müsse.
Verbesserte Datenlage über die Situation Geflüchteter im deutschen Bildungssystem
Im Rahmen von ReGES wurden geflüchtete Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien zu mehreren Zeitpunkten (= Erhebungswellen) befragt. Eltern und Jugendliche machten Angaben zu persönlichen und fluchtspezifischen Merkmalen sowie zu ihrem Leben und ihren Bildungserfahrungen in Deutschland. Die Geflüchteten hatten auch Gelegenheit, über Bildungsziele und Zukunftswünsche zu berichten. Auch Daten der pädagogischen Fachkräfte sowie der haupt- und ehrenamtlich in den Gemeinden und Gemeinschaftsunterkünften Tätigen wurden erhoben. So konnte die Studie ReGES eine reichhaltige Datenbasis über die Situation von geflüchteten Kindern und Jugendlichen im deutschen Bildungssystem schaffen, die in Kürze auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Nutzung zur Verfügung steht. Die bislang publizierten Arbeiten beziehen sich vorwiegend auf die erste Erhebungswelle. Weitere Analysen mit den Daten der späteren Erhebungswellen sind in Vorbereitung.
Neue Studie am LIfBi: „Bildungswege von geflüchteten Kindern und Jugendlichen“
Ende Januar wurde die Förderung eines neuen Projekts „Bildungswege von geflüchteten Kindern und Jugendlichen“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bewilligt, das auf dem Datenbestand der Studie ReGES aufbaut. Das Projekt untersucht mit längerfristiger Perspektive Bildungswege sowie Bildungsentscheidungen von jungen Geflüchteten an zentralen Schnittstellen des deutschen Bildungssystems.
Der vollständige Bericht zum Projekt ReGES ist auf https://www.lifbi.de/reges zu finden.
Über das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi)
Das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) in Bamberg untersucht Bildungsprozesse von der Geburt bis ins hohe Erwachsenenalter. Um die bildungswissenschaftliche Längsschnittforschung in Deutschland zu fördern, stellt das LIfBi grundlegende, überregional und international bedeutsame, forschungsbasierte Infrastrukturen für die empirische Bildungsforschung zur Verfügung.
Kern des Instituts ist das Nationale Bildungspanel (NEPS), das am LIfBi beheimatet ist und die Expertise eines deutschlandweiten, interdisziplinären Exzellenznetzwerks vereint. Großprojekte, an denen das LIfBi beteiligt oder führend ist, sind neben der Geflüchtetenstudie ReGES auch das schulbezogene Inklusionsprojekt INSIDE oder die Förderstudie für benachteiligte Kinder und Familien BRISE. Grundlage dafür sind die eigenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, insbesondere die fundierte Instrumenten- und Methodenentwicklung für längsschnittliche Bildungsstudien, von der auch andere Infrastruktureinrichtungen und ‑projekte profitieren.
Das könnte Sie auch interessieren...
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“
Bundesfreiwilligendienst bei goolkids
„Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hatte ich schon immer“, betont Christina Weiss, die zum Jahresanfang beim Förderkreis goolkids ihre Tätigkeit als Bundesfreiwilligendienstleistende begann. Wir haben mit ihr und goolkids-Initiator Robert Bartsch zurückgeblickt.
Während der Schulzeit war sie unter anderem als Tutorin für jüngere Schülerinnen und Schüler tätig, hat im Ferienprogramm ihrer Heimatstadt unterstützt und in der Kirchengemeinde als Konfirmandenbetreuerin Ausflüge und Gruppenarbeiten betreut. Nach dem Studium hat sie ein Bundesfreiwilligenjahr absolvieren wollen, bei dem sie Sport mit Sozialem verbinden kann. „Ich glaube, dass es wenige, richtungsweisende Entscheidungspunkte im Leben gibt, an denen man erstmal komplett frei und flexibel ist. Der Abschluss der Schule ist so ein Punkt, aber auch der Abschluss eines Studiums. Ich dachte, ok, jetzt habe ich Zeit, etwas ganz anderes zu machen und andere Erfahrungen zu sammeln, also wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Zeit in ein soziales Projekt mit Sport zu stecken erschien mir doppelt logisch – etwas Sinnvolles tun und eine Menge Spaß dabei haben.“
Aus der Forchheimer Gegend war Christina Weiss nach einem Dualen Studium und einem Auslandspraktikum zum weiteren Studium nach Regensburg gezogen. Nachdem dieses mit dem Master erfolgreich beendet war, stieß sie im Herbst vergangenen Jahres auf die von goolkids ausgeschriebene Stelle.
Genehmigung für zwei Budfi-Stellen
Die Verantwortlichen waren schon einige Monate auf der Suche nach einer Nachfolge für den scheidenden Julius Rosiwal, der bis Mitte vergangenen Jahres erster Bundesfreiwilligendienstleistender überhaupt bei goolkids war.
Während er damals direkt von der Schule kam, viele bürokratischen Hürden erst genommen werden mussten, taten sich beide Seiten diesmal leichter als damals, als sowohl goolkids als auch Rosiwal Neuland betreten hatten. „Mit absoluter Gewissheit ging es dieses Mal leichter von der Hand. Lauras Vorgängerinnen hatten hier gute Vorarbeit geleistet, so dass der doch sehr bürokratische Vorgang schneller und lockerer bewältigt werden konnte“, sagt Robert Bartsch. „Laura“ – das ist Laura Stelzer, die für goolkids als Sozialarbeiterin tätig ist und die Projektleitung für das Inklusionsprojekt ginaS innehat.
Für Christina Weiss sieht Bartsch auch den Vorteil, erst nach ihrem Studium als Bufdi eingestiegen zu sein. „Dadurch gelingt es ihr auch in diesen Zeiten leichter, den Anschluss an die Projekte und Ziele zu finden. Menschlich sehe ich keinen Unterschied – am liebsten hätten wir gerne Beide und dauerhaft bei uns.“ Möglicherweise geht sein Wunsch nach zwei Bundesfreiwilligendienstleistende in der Zukunft in Erfüllung – denn der Förderkreis ist wieder auf der Suche. Und goolkids hat die Genehmigung, zwei Budfi-Stellen zu besetzen.
Digitales Inklusives Sportfest in Planung
Momentan ist das goolkids-Team dabei, die Sportangebote als digitale Treffs aufzubauen und so gut es geht auch sportliche Elemente zu integrieren. Zur weiteren Motivation hatte Christina Weiss die Idee, solange gemeinsamer Sport nicht möglich ist, unter dem Motto #machMITtwoch jeden Mittwoch ein Video auf Instagram zu posten, das Anregungen zu Sport und Bewegung bieten soll.
„Außerdem unterstütze ich bei der Aktuell-Haltung von Homepage und Facebook-Seite. Zudem helfe ich, eine geplante Reihe von Inklusionstagen an Schulen zu organisieren, und es läuft die Planung für das Sportfest.“ Gemeint ist das inklusive Sportfest, für dessen Planung sie verantwortlich ist. Dieses hätte vergangenes Jahr Premiere feiern sollen, was allerdings Corona zum Opfer fiel. Auch in diesem Jahr kann es nicht als physische Veranstaltung stattfinden, stattdessen wird es digital vonstattengehen.
„Die Kunst liegt auf jeden Fall darin, seit Corona ständig zweigleisig zu fahren. Das heißt aber auch, dass nicht alle Ideen umgesetzt werden können“, so Robert Bartsch. „Nicht jede Sportart kann so ohne weiteres innerhalb von Stunden auf neue Vorgaben umgestellt werden. Auch den teilnehmenden Vereinen ist es nicht immer möglich, die Kontaktvorgaben ständig neu zu justieren; gerade im Hinblick auf Kontaktsport.“ Dank dieser Weitsicht kann nun das Integrative Sportfest immerhin eine virtuelle Premiere feiern.
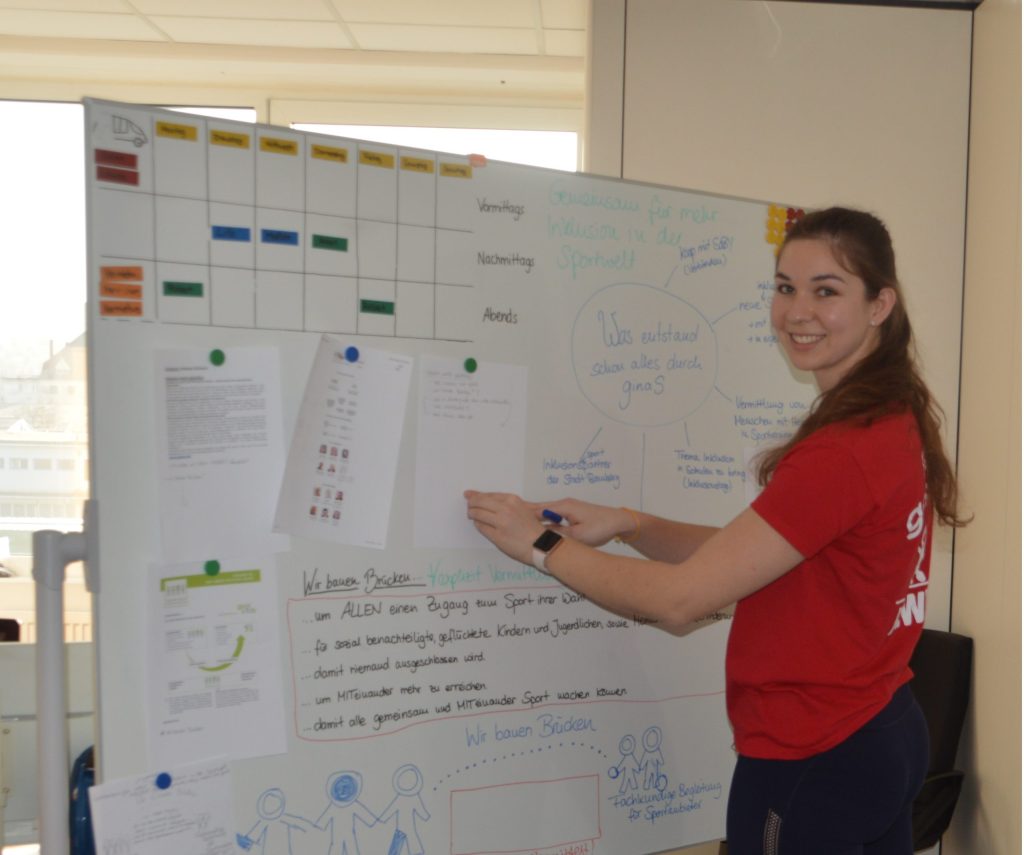
Organisation ist Alles! Home-Office jederzeit möglich
Optimal war der Start zu Jahresbeginn aufgrund der Pandemie nicht, doch alles hat gut geklappt und sich eingespielt, wie beide betonen. „Am Anfang war ich im Büro, zur Einführung und bis technisch alles eingerichtet war. Jetzt bin ich die meiste Zeit im Homeoffice und die Abstimmung geht über E‑Mail, Telefon, WhatsApp und Onlinemeetings – eigentlich genauso wie im sonstigen Leben derzeit“, resümiert Frau Weiss.
„goolkids ist mittlerweile so organisiert, dass jederzeit auch Home-Office möglich ist“, ergänzt Robert Bartsch. „Teambesprechungen finden vorwiegend per Video-Chat statt und persönliche Besprechungen wären in den neuen Räumen auch mit großem Abstand ein Mal wöchentlich machbar.“
Natürlich sehnen alle herbei, dass es endlich wieder physische Veranstaltungen gibt, die durch das virtuelle Interagieren nicht ersetzt werden können. „Wenn wir Spaß bei den virtuellen Treffen der Sportangebote haben und ich eine Idee bekomme, was für coole Sportgruppen da normalerweise zusammen in der Halle, auf dem Feld oder im Studio sporteln!“
Während der Bundesfreiwilligen-Zeit gilt es für die Freiwilligen, diverse je eine Woche dauernde Schulungen zu besuchen. Auch diese fanden in diesem Jahr virtuell statt. „Tatsächlich fand ich den Kontakt und den Austausch mit den anderen Bundesfreiwilligendienstleistenden am spannendsten – das wäre natürlich live noch cooler gewesen, hat aber eigentlich auch so ganz gut geklappt“, betont Christina Weiss. Neben dem Seminar zu politischer Bildung fielen in ihre Zeit noch drei weitere unter den Mottos „Kompetenz“, „Abschluss“ und „Vertiefung“.
Wenn sie zurückschaut, was sie in der Zeit bei goolkids Neues lernen konnte, meint sie, sie habe wahrscheinlich noch nie so hautnah erlebt, dass adressatengerechte Kommunikation unfassbar wichtig sei, „schließlich ist das Hauptziel ja immer, die eigene Message so zu vermitteln, dass sie bei einer anderen Person auch genauso ankommt. Virtuell ist das natürlich nicht immer so leicht. Um hier noch dazuzulernen, habe ich zum Beispiel auch angefangen, mich mit Leichter Sprache zu beschäftigen.“
Das könnte Sie auch interessieren...
Verein hofft auf Spenden für neue Räume
Neue Heimat für „Freund statt fremd“
Auch die neue Anlaufstelle soll ein Ort der Begegnung bleiben: Zum 1. September zieht der Verein „Freund statt fremd“ in die Schützenstraße 2a. Zur Finanzierung einiger Umbaumaßnahmen und für den Umzug bittet der Verein um Spenden und freut sich gleichzeitig über tatkräftige Hilfe beim Gestalten der neuen Räume.
Oberbürgermeister Andreas Starke: „Dieser Verein ist wichtig und fördert die Integration in unserer Stadt.“
Drei Jahre lang bot die Begegnungsstätte in der Luitpoldstraße 20 in Bamberg dem Flüchtlingshilfe-Verein „Freund statt fremd“ ein angenehmes Dach über dem Kopf. Der Mietvertrag für die Räume war größtenteils durch geförderte Projekte mitfinanziert, die nun auslaufen. „Also haben wir uns nach etwas Neuem umgesehen, das kleiner und leichter zu finanzieren ist“, erklärt Sylvia Schaible, eine von insgesamt vier Vereinsvorsitzenden. Abhilfe schaffen konnte die Stadtbau Bamberg GmbH Bamberg: In zentraler Lage am Schönleinsplatz, genauer gesagt in der Schützenstraße 2a, wurden Räume frei, weil das Planungsbüro der Stadtbau dort ausgezogen ist. Vor Ort wird die neue Begegnungsstätte mit dem Namen „Blaue Frieda“ entstehen, deren Herzstück wieder ein kleiner Café-Betrieb ist. Der Umzug ist möglich geworden, weil sich die Stadtspitze intensiv eingesetzt hat, um die Zukunft des Vereins zu sichern. In mehreren Gesprächsrunden konnte dieses Ergebnis einvernehmlich erarbeitet werden.
Begegnung und Integration
Die Vorfreude auf den Umzug ist groß, allerdings ist der Verein auf Hilfe angewiesen: Eine neue Wand plus Tür soll eingezogen werden, um ein Kurszimmer zu schaffen. Die Küche braucht einen neuen Herd, Backofen und Spülmaschine sowie eine Küchentheke. Außerdem sind Handwerkerleistungen im Bereich Elektro und Trockenbau nötig. Warum all das hergerichtet werden muss, zeigt ein Blick auf die zahlreichen Aktivitäten des Vereins, dessen Hauptanliegen Begegnung und Integration sind – um nur einige Beispiele zu nennen: interkulinarische Kochkurse, Sprachcafé, Nachhilfe für Schüler:innen, ehrenamtliche Sprachkurse, Vorträge, Filmvorführungen, Spieleabende oder Kunstprojekte – und natürlich Raum für Austausch, zum Kennenlernen und zur Begegnung.
Die Stadtbau freut sich über den neuen Mieter und unterstützt den Verein nach Kräften. Bereits einen Monat vor dem vereinbarten Mietbeginn, am 1. August, können die Umbauarbeiten und erste Umzugsmaßnahmen beginnen.
„Es ist selbstverständlich, dass sich die Stadtspitze dem Spendenaufruf anschließt. ‚Freund statt fremd‘ ist mittlerweile eine echte Institution in der Flüchtlingshilfe in Bamberg“, sagt Oberbürgermeister Andreas Starke. Zweiter Bürgermeister und Sozialreferent, Jonas Glüsenkamp, betont: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Stadtbau einen neuen Ort für die wichtige Arbeit finden konnten. Jetzt geht es darum, ‚Freund statt fremd‘ bei der Arbeit weiter zu unterstützen. Wir tun dies als Stadt, hoffen darüber hinaus aber auf Unterstützung aus der gesamten Stadtgesellschaft.“
Wer tatkräftig mit anpacken möchte wird gebeten, sich vorab beim Verein zu melden. Die Geschäftsstelle ist unter der Telefonnummer 0951⁄91418935 oder per E‑Mail kontakt@freundstattfremd.de zu erreichen. Gesucht sind Ehrenamtliche, die beim Streichen und Putzen der neuen Räume helfen sowie beim Umzug.
Das Spendenkonzept von „Freund statt fremd“:
Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden:
DE40 7705 0000 0302 768361, Sparkasse Bamberg
Direkt online spenden kann man auch auf der Homepage des Vereins https://freundstattfremd.de/
Besonders freut sich FSF über regelmäßige Spender:innen per Dauerauftrag: In einem neuen Konzept bietet FSF mehrere Freundschaftsangebote an: Vom „Klein-aber-fein-Freund“ bis zur „Superlieblingsfreundin“.
Für Firmenfreunde mit Unterstützungssummen ab 777 Euro wird der Verein im neuen Domizil ein Firmenfreundefenster „777FFF“ mit deren Firmenlogos einrichten.
Das könnte Sie auch interessieren...
Neuer Vorstand des MIB
“Die Herausforderungen der Integration werden nicht kleiner”
Der Migrantinnen- und Migrantenbeirat der Stadt Bamberg (MIB) hat seinen neuen Vorstand gewählt. Seit Anfang März leiten, wie sie es im zurückliegenden Jahr bereits kommissarisch taten, Mitra Sharifi und Marco Depietri als Doppelspitze den MIB. Wir haben mit den beiden über die kommenden Aufgaben, die Auswirkungen der Pandemie auf Integration und Identitätspolitik gesprochen.
Frau Sharifi, Herr Depietri, wieso sind Sie zur Wahl als Doppelspitze angetreten?
Mitra Sharifi: Als unser ehemaliger Vorsitzender Mohamed Addala 2018 zurückgetreten ist, habe ich den Vorschlag gemacht, mit einer Doppelspitze weiterzumachen. Erstens weil ich finde, dass der Vorsitz des MIB eine Aufgabe ist, die sich auch gut von zwei Leuten machen lässt und zweitens, weil wir auch im Vorstand, und in unseren Strukturen, Diversität haben möchten. Und in der Zeit, in der Herr Depietri und ich als Doppel gearbeitet haben, haben wir festgestellt, dass diese Konstellation sehr gut funktioniert. Wir ergänzen uns und können gut miteinander. Deshalb wurde die Satzung des MIB dahingehend geändert, dass auch zwei Leute den Vorstand innehaben können, und wir haben uns gemeinsam zur Wahl gestellt.
Marco Depietri: Ich muss sagen, dass ich am Anfang ein bisschen skeptisch gegenüber der Satzungsänderung war, weil wenn immer zwei Leute zur Wahl antreten müssen, aber der Fall eintritt, dass sie sich nicht verstehen, müsste man die Satzung wieder zurückändern. Eine Doppelspitze kann nur funktionieren, wenn man sich gut versteht. Darum sieht die Satzung jetzt vor, dass auch andere Szenarien ohne Doppel möglich sind und bei Bedarf eine Person Vorsitzende*r werden kann.
Wer hat welche Aufgaben?
Mitra Sharifi: Ganz genau haben wir die Aufgaben noch nicht festgelegt. Aber Herr Depietri übernimmt zum Beispiel schon jetzt sehr viel unsere Online-Arbeit. Gerade in der Pandemie hat er uns damit sehr geholfen. Auch im Bereich Stadtteilarbeit, in dem wir noch mehr machen wollen, ist stärker Marcos Aufgabe. Die Organisation der Internationalen Wochen gegen Rassismus, die gerade zu Ende gegangen sind, habe hingegen ich übernommen. Abgesehen von uns zwei haben wir im Vorstand sehr kompetente und engagierte Kolleg*innen, mit denen wir die Aufgaben teilen werden.
Bei der Wahl gab es keine Gegenkandidat*innen. Trotzdem gingen, bei einer ungültigen Stimme, nur 13 von 20 Stimmen an Sie. Sechs Personen haben also gegen Sie gewählt. Wie gehen Sie mit dieser Ablehnung um?
Mitra Sharifi: Ich glaube, dass diese sechs Leute im MIB immer noch starke Probleme mit dem Wahlbrief der SPD von 2019 haben, der möglicherweise gegen den Datenschutz verstoßen hat. Dieser mögliche Verstoß hat aber nichts mit dem MIB zu tun. Der Beirat hatte nichts falsch gemacht, sondern die Stadtverwaltung hatte die Daten an die SPD gegeben. Das ist nach dem Wahlgesetz erlaubt, allerdings nur nach Alter und Adresse sortiert. Verwaltung und Oberbürgermeister hatten angenommen, dass die Sortierung von Adressen auch nach dem Merkmal der Nationalität erlaubt sei, was nun von einem Gericht anders gesehen wurde. Aber der MIB hatte mit dem Ganzen gar nichts zu tun. Im Übrigen war Herr Addala auch mit 13 Stimmen gewählt worden.
Werden Sie versuchen, diese sechs Leute umzustimmen?
Marco Depietri: Das ist auf jeden Fall unser Wunsch. Ob wir das hinkriegen, wird sich zeigen. Aber das Vertrauen wieder herzustellen, ist keine Einbahnstraße – es muss auch etwas von diesen Leuten kommen. Wir werden aber nicht versuchen, die kritischen Stimmen zu isolieren. Es gibt viel zu tun und wir können unsere Aufgabe nur gemeinsam bewältigen.
Mitra Sharifi: Wir haben uns darum bemüht, die Bedenken dieser Kolleg*innen auszuräumen. Leider haben wir das noch nicht geschafft. Mir scheint, dass sich die Verhältnisse bei diesem Thema ein bisschen festgefahren haben. Es gab auch Forderungen, Marco solle nicht zur Wahl antreten oder die Wahl zu verschieben, bis der Prozess gegen den OB geklärt ist. Aber eine große Mehrheit im Beirat hat dies abgelehnt und will nach vorne schauen. Wir arbeiten daran, dass Vertrauen wieder entsteht. Ich hoffe, dass Marco an seinen Taten beurteilt wird und Stadtrat, Parteien und Medien uns die Chance geben, unsere Arbeit zu machen.
Aber finden Sie die Bedenken beziehungsweise Anschuldigungen an sich falsch?
Marco Depietri: Ich habe die Sache schon in der öffentlichen Sitzung vom April 2020 erläutert und geklärt und mich für die Irritationen entschuldigt. Das habe ich dann auch in anderen Sitzungen sowie zuletzt in der Wahlsitzung wiederholt. Man konnte im Vorfeld nicht wissen, welche Auswirkungen der Wahlbrief hat. Es gibt im MIB zwar auch Mitglieder, die den Brief nicht für einen Fehler halten, aber ich habe auch gesagt, dass jede Irritation eine Irritation zuviel ist. Es ist natürlich berechtigt, dass andere anders denken. Aber ich habe in langen Sondersitzungen jede Frage zum Thema beantwortet und wir möchten es beenden und im MIB ein neues Kapitel aufschlagen.
Vorher haben Sie die Doppelspitze des MIB kommissarisch ausgefüllt, jetzt sind Sie wirklich an der Macht. Was hat sich seit der Wahl geändert?
Mitra Sharifi: Eigentlich nicht viel. Aber man wird vom MIB mehr hören – auch in der Kommunalpolitik. Wir haben uns vorgenommen, weil wir ja auch unsere Ausschüsse neu gewählt haben, mehr Themen gründlicher zu bearbeiten und auch mehr Anträge in der Politik einzubringen, um die Interessen von Migrant*innen noch deutlicher zu artikulieren.
Marco Depietri: Mitra hat es schon erwähnt – die Stadtteilarbeit wird in den nächsten Jahren grundlegend für uns. Wir wollen nicht, dass die Migrant*innen zu uns kommen müssen, sondern wir kommen zu ihnen.
Was sind die drängendsten Probleme, die der MIB angehen will?
Mitra Sharifi: Wir stellen fest, dass politische Entwicklungen, und auch Corona, die gesellschaftliche Spaltung zwischen migrantischen und nicht-migrantischen Bevölkerungsteilen vertiefen. Zum Beispiel im Bildungsbereich. Das ist zwar kein rein kommunales Problem, sondern ein strukturelles, aber hier werden wir aktiv werden. Kinder mit Migrationsgeschichte stehen noch zu oft vor strukturellen Barrieren, die ihnen den Zugang zu Bildung erschweren. Wir wollen den Zusammenhalt stärken und auf kommunaler Ebene die Möglichkeiten ausschöpfen, damit Kinder mehr Chancengleichheit haben. Ein anderer wichtiger Bereich, ist der Einsatz für eine Antidiskriminierungsstelle, damit Rassismus und Diskriminierung ernster genommen werden. Wir möchten Betroffene stärken, ihnen mehr Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein in der Stadtgesellschaft ermöglichen und grundlegend mehr präventive Arbeit machen. Die Stadtteilarbeit wäre wieder ein gutes Beispiel. Gerade in der Begegnung zwischen Kulturen kann man Vorurteile abbauen und Menschen erreichen, die sonst vielleicht von Rechtspopulisten erreicht werden würden. Wir wollen auch die Mehrheitsgesellschaft ansprechen und gerade in den Stadtteilen ist es nicht so wichtig, woher man kommt, sondern was ein Stadtviertel braucht, um das Leben dort besser zu machen.
Aber wie sind Begegnungen in der begegnungslosen Pandemiezeit möglich?
Mitra Sharifi: Unmöglich ist es nicht. Wir haben uns fast ohne Pause in der ganzen Pandemiezeit digital getroffen und Veranstaltungen durchgeführt. Aber natürlich haben wir die Hoffnung, dass es bald wieder besser wird. Allerdings habe ich die Sorge, dass das ohnehin begrenzte Budget für Anti-Diskrimininierungs-Projekte oder im sozialen Bereich durch Corona noch kleiner wird. Integration ist eine freiwillige Aufgabe und solche Dinge sind immer die ersten, die gestrichen werden, wenn gespart werden muss.
Macht die Pandemie Integration schwieriger?
Mitra Sharifi: Die Herausforderungen der Integration werden nicht kleiner. Wir wissen, dass Migrant*innen von Corona und den wirtschaftlichen Folgen der Pandemiebekämpfung stärker betroffen sind, weil sie viel öfter in beengten Wohn- und prekären Arbeits-Verhältnissen leben und keine Reserven haben. Auch Schüler*innen mit Migrationsgeschichte, die noch Sprachförderung brauchen, aber kaum Zugang zu digitalen Unterrichtsmöglichkeiten haben, haben ein verlorenes Jahr hinter sich. Wir machen uns große Sorgen, wie diese Lücken geschlossen werden können.
Das zuletzt ratlos wirkende und nur wenig wirkungsvolle Vorgehen der Bundesregierung in der Pandemiebekämpfung wird auch noch begleitet von einem Hin und Her der konkreten Maßnahmen und der Kommunikation. Wie kommt das politische Vorgehen in migrantischen Kreisen an?
Mitra Sharifi: Am Anfang der Pandemie waren die Leute sehr dankbar, dass es hier klarere und bessere Regelungen gab als in ihren Heimatländern. Aber man hat auch in migrantischen Kreisen begonnen, die deutschen Maßnahmen mit denen anderer Länder zu vergleichen und sieht, wie langsam zum Beispiel die Impfkampagne vorankommt. Allgemeine Regeln wie das Tragen von Masken oder Abstandhalten zu kommunizieren ist kein Problem. Wenn wir aber spezifische Regelungen weitergeben wollen, die an lokalen Zuständen oder Inzidenzen festgemacht und alle paar Tage angepasst werden müssen, wird es schwerer. Wir haben beim bayerischen Staatsministerium versucht, schnell Informationen in verschiedenen Sprachen über Regeln, die sich schnell ändern, zu bekommen. Da gibt es zum Teil immer noch Probleme.
Ein Thema, das in den letzten Wochen einen großen Teil der Berichterstattung ausmachte, ist die sogenannte Identitätspolitik. Die einen loben sie als emanzipatorische Bewegung diskriminierter Gruppen, die Menschen eine Stimme und Einfluss verleiht, die geschichtlich unterdrückt waren und ihre Bedürfnisse und Forderungen bisher politisch-gesellschaftlich nicht einbringen konnten. Andere kritisieren sie als debattenfeindlich, weil sie die Gültigkeit von Argumenten zu oft an Betroffenheit von Diskriminierung und/oder Hautfarbe anstatt am Inhalt der Argumente festmacht. Wie stehen Sie zur Identitätspolitik?
Mitra Sharifi: Ich freue mich darüber, dass Rassismus seit einigen Monaten viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommt und viel deutlicher angeprangert wird – dass auch marginalisierte und von Diskriminierung betroffene Gruppen ihre Stimme erheben können. Es gibt gesellschaftliche Macht-Strukturen, die Benachteiligung verursachen. Diese Strukturen muss eine Gesellschaft sehen und anerkennen, um sie ändern zu können. Wenn Menschen allerdings nur über ihre Merkmale, seien es Geschlecht, Hautfarbe oder Sexualität, definiert werden und derart extrem getrennt wird, dass über, zum Beispiel, Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe nur mitreden darf, wer davon betroffen ist, finde ich das nicht gut. Ich finde es gut, wenn man, wie aktuell beim Beispiel der Übersetzung des Textes von Amanda Gorman, zuerst schaut, ob es für die Aufgabe nicht eine schwarze Übersetzerin gibt. Schlecht ist aber, wenn Hautfarbe oder Geschlecht die Identität alleine bestimmen. Wir befinden uns noch in einer solchen gesellschaftlichen Ungleichheit, dass wir noch eine ganze Zeit lang Gleichstellungspolitik machen müssen. Diese Politik bedeutet unter anderem, ein gesellschaftliches Bewusstsein der strukturellen Ungleichheit zu entwickeln und strukturell benachteiligte Gruppen zu fördern. Dafür müssen diskriminierte Gruppen ihre Stimme erheben und ihre Identität behaupten, während gesellschaftlich privilegierte Gruppen diese Bestrebungen aushalten und akzeptieren müssen, einen Teil ihrer Privilegien abzugeben. So, hoffe ich, kann man eine Gesellschaft dahingehend ändern, dass alle Menschen gleich sein können.
Marco Depietri: Menschen mit bestimmten Merkmalen, wie nicht-weißer Hautfarbe, machen andere Erfahrungen im Leben als Weiße. Wir müssen ihnen zuhören und offen für ihre Sicht sein. Deshalb finde ich es gut, wenn diese Leute ihre Rechte verlangen. Aber nicht alle gegen alle, sondern gemeinsam.
Das könnte Sie auch interessieren...
Bamberger Bildungsentwicklungsplan
Bildungsbüro veröffentlicht Studienband „Fokus Migration und Integration“
Das Ziel der Stadt Bamberg ist es, allen Menschen – unabhängig von Herkunft und sozialem Status – ein gutes und leicht zugängliches Bildungsangebot zu machen. Integration durch Bildung ist alternativlos. Zu dem Themenbereich „Fokus Migration und Integration“ des Bildungsplans legt das Bildungsbüro einen Querschnittsband vor, der aktuelle Daten und Informationen zum Bereich Integration durch Bildung in Bamberg zusammenfasst.
Die Themen Migration und Integration rücken seit Jahren mehr in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, denn Bamberg ist vielfältig! Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern verlagern ihren Lebensmittelpunkt für eine gewisse Zeit oder dauerhaft aus verschiedenen Gründen nach Bamberg. Sie bilden eine heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Voraussetzungen, was das kommunale Bildungssystem vor neue Herausforderungen stellt, aber auch neue Impulse und Chancen bietet. Ziel in der Stadt Bamberg ist es, allen Menschen – unabhängig von Herkunft und sozialem Status – ein gutes und leicht zugängliches Bildungsangebot zu machen. Integration durch Bildung ist alternativlos, denn Bildung ist in jedem Alter ein Schlüssel für die Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben und vereinfacht Aufstiegschancen.
Zu dem Themenbereich „Fokus Migration und Integration“ des Bildungsplans legt das Bildungsbüro einen Querschnittsband vor, der aktuelle Daten und Informationen zum Bereich Integration durch Bildung in Bamberg zusammenfasst. Er kann damit als Grundlage für zukünftige (bildungs-)politische Entscheidungen in der Stadt herangezogen werden. Anders als bei den bisherigen bei den bisherigen fünf Publikationen, die jeweils einen Bildungsabschnitt behandelten, betrachtet dieser Band das komplexe Thema Migration und Integration über den Lebensverlauf hinweg von der Kita bis zur beruflichen und non-formalen Bildung. „Uns war es von Beginn an wichtig, das Thema Migration nicht nebenbei in den fortlaufend erscheinenden Bänden abzuhandeln, sondern uns in einer eigenen Ausgabe intensiv mit der Thematik zu beschäftigen,“ so Dr. Ramona Wenzel, die verantwortliche Mitarbeiterin im Bildungsmonitoring.
Band benennt abschließend klare Handlungsfelder
Der Band fasst zunächst die demographischen Rahmenbedingungen der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zusammen. Er gibt einen Einblick in die Situation in der frühkindlichen Bildung und stellt Angebote der Sprachförderung vor. Das Kapitel „Schulische Bildung“ befasst sich mit einem für die Integration zentralen Bildungsort und beleuchtet die Zusammensetzung der Schülerschaft mit Migrationshintergrund, das Übertrittsverhalten und die erworbenen Abschlüsse auch im Vergleich zur Schülerschaft ohne Migrationshintergrund. Während im Kapitel „Berufliche Bildung“ die Schüler- und Absolventenzahlen an den beruflichen Schulen beziehungsweise Unterstützungsmöglichkeiten der Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration in den Blick genommen werden, fokussiert ein weiteres Kapitel den Hochschulbereich. Auch Sprachförderung im Rahmen von Integrations- und Berufssprachkursen und die Angebote non-formaler und kultureller Bildung sowie ehrenamtliches Engagement werden betrachtet. Der ANKER-Einrichtung Oberfranken mit den ihr eigenen Strukturen als Herausforderung auch für den Bildungsbereich widmet sich das letzte Kapitel. Abschließend gibt der Band einen Ausblick auf die bevorstehenden Herausforderungen und benennt hierbei klare Handlungsfelder. Dazu gehören beispielsweise der (weitere) Ausbau von Platzkapazitäten in frühkindlichen und schulischen Bildungseinrichtungen als zentrale Orte des Spracherwerbs und der sozialen Integration. Weiteren Handlungsbedarf gibt es bei der Schulung des pädagogischen Personals für kultursensible Kommunikation und Interaktion in den sich ändernden Gruppen und Klassenzusammensetzungen oder bei der Einbindung und Stärkung der Eltern in den Bildungsprozess.
Die Veröffentlichung steht, wie alle bisherigen Bände, auf der Seite https://www.stadt.bamberg.de/Bildungsentwicklungsplan zum Download zur Verfügung.
Der abschließende Band des Bamberger Bildungsentwicklungsplans zum Themenbereich „Kulturelle Bildung und lebenslanges Lernen“ wird im Sommer 2021 erscheinen.
Das Jahr im Schnelldurchlauf
9 Fragen, 9 Antworten mit Robert Bartsch
Der Förderkreis goolkids, der sich um Inklusion und Integration kümmert, ist mittlerweile fünf Jahre alt. In der Serie „Das Jahr im Schnelldurchlauf” lassen wir heute Robert Bartsch, den Initiator der Bamberger Organisation, auf 2020 zurückblicken und einen Ausblick in das kommende Jahr wagen.
Herr Bartsch, das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Wenn sie so kurz vor dem Jahreswechsel zurückblicken: Was nehmen Sie als Fazit aus diesem Jahr mit?
Wir dürfen uns nie sicher sein, dass Gesundheit eine Selbstverständlichkeit ist. Die Krise hat mir gezeigt, wer die echten Freunde sind und wie sie sich in solchen Zeiten verhalten.
Was war das Schlimmste für Sie an diesem Jahr?
Die Erkenntnis, dass die Gesellschaft mehr und mehr von Egoismus geprägt wird. In der Krise wurden eher Konfrontation und Streit statt ein MITeinander gesucht. Menschen am Rand der Gesellschaft wurden noch mehr ignoriert und besonders unsere Schützlinge bei goolkids hatten/haben extrem stark mit der Ausgrenzung zu kämpfen.
Wenn Ihnen vor dem Lockdown im Frühjahr gesagt worden wäre wie sich die Situation zum Ende des Jahres darstellt, wann und wie hätten Sie seitdem anders gehandelt als Sie es getan haben?
Vielleicht hätten ich beziehungsweise unser Team noch intensiver auf digitale Angebote für Training im eigenen Zuhause setzen sollen? Aber generell hatten auch wir sehr viel mit der akuten Versorgung oder persönlichen Betreuung unserer Mitmenschen zu tun. Einkaufsservice oder Gesprächszeiten per Telefon/Video waren so wichtig für sie, um sich nicht gänzlich abgehängt zu fühlen.
Wenn Sie eine positive Sache aus diesem Jahr herausstellen möchten, welche wäre das?
Es gab eine extrem große Welle der Hilfsbereitschaft; sogar mehr als Hilfen angefragt wurden. Das Schöne daran, bei all den tollen Helfern und Hilfsangeboten war es leicht, die Hassprediger und Lügner zu ignorieren. Es war viel leichter oder es gelang früher, die Guten unter den Menschen zu erkennen. Wir waren und wir sind mehr!
Auch Weihnachten wird für die meisten Menschen anders stattfinden als in den Jahren zuvor. Wie verbringen Sie das Fest?
Da ich keine Familie habe, muss (darf?) ich das Fest alleine verbringen. Ich nutze die Zeit, all die schönen Bilder aus den wenigen Begegnungen mit unseren Freunden in den Projekten von 2020 ins Gedächtnis zu rufen. Ich genieße die wunderbaren Stunden noch einmal und gönne mir dabei leckere Weihnachtsgeschenke, die ich von sehr guten Freunden bekommen habe.
Aufgrund der Erfahrungen in diesem Jahr: Wie verändert sich der private Robert Bartsch und wie seine Arbeitsweise für die Zukunft?
Der private Mensch wird noch mehr an seinen Stärken arbeiten. Sie haben mich durch die Krise geführt und gezeigt, dass Menschlichkeit ein Geschenk ist, das man pflegen darf. Für die Arbeit bedeutet das kaum Unterschiede, weil mir die Ziele schon immer mehr bedeutet haben als kurzfristiges Schulterklopfen. Vielleicht werde ich sie noch intensiver verfolgen als bisher?
Was bereitet Ihnen Sorgen im Hinblick auf das neue Jahr?
In Wahrheit der Gedanke, dass die Hassreden und Verschwörungsmärchen noch ungehemmter und noch dümmer werden. Dass sich die schleichende Spaltung weiter fortsetzt, weil die Bewältigung der Pandemie nicht im Sinne der egoistischen Motive dieser Leer(nicht)denker geschafft werden kann. Noch mehr Sorgen bereitet mir die Politik mit ihren zunehmend populistischen statt weit blickenden Pauschal-Entscheidungen. Man ist zu faul, oder sind es Lobbyinteressen, die Möglichkeiten von Maßnahmen differenzierter einzusetzen. Es wird immer nur über den Kamm geschert, koste es (Steuergelder und Pleiten) was es wolle. Dies führt zu einer Entfremdung, die durch nichts mehr repariert werden kann. Die Wahlen werden es hoffentlich den „Königen“ dieses Landes zeigen.
Welche Wünsche haben Sie für das neue Jahr?
Gesundheit! Was sonst ist wichtig für uns? Mehr MITeinander, wenig Egoismus, weniger Streit und vor allem, mehr Weitsicht bei Politikern und bei den Menschen selbst. Dann gelingt es schon bald wieder, gemeinsam in unseren Projekten das Leben und den Sport zu genießen. Neue Begegnungen braucht das Land.
Was macht Ihnen Mut für das neue Jahr?
Schlechte Zeiten machen uns bewusst, wie wertvoll das Leben ist. Doch schlechte Zeiten sind nie von Dauer. Ich vertraue darauf, dass sich das Pendel wieder in die bessere Richtung dreht. Es gab sogar in schweren Tagen neue Begegnungen, die für die guten Zeiten richtige Lebensfreude versprechen.
Das könnte Sie auch interessieren...
Förderverein goolkids
Benefiz-Golfturnier zugunsten von Integration und Inklusion
Menschen durch Sport zu verbinden! Das ist der Leitgedanke, den der Förderverein goolkids verfolgt. Ob klein oder groß, mit oder ohne Behinderung, welcher Nation oder Religion auch immer sie angehören, bei goolkids geht es um das Miteinander, oder in der goolkids-Schreibweise MITeinander. Im Oktober fand zum zweiten Mal das „BKM-Mannesmann-Benefiz-Golfturnier“ auf der Golfanlage Gut Leimershof statt, das dazu dienen sollte, auf den Förderkreis goolkids und dessen Projekt ginaS aufmerksam zu machen und dessen Erlös deren Projekten zukam. Robert Bartsch, der Initiator von goolkids, und Laura Stelzer, die Projektleiterin von ginaS, blickten für uns zurück auf die Veranstaltung.
Im vergangenen Jahr kam Benedikt Zenglein von der Golfanlage Gut Leimershof auf Robert Bartsch zu und schlug vor, ein Benefiz-Golfturnier auf die Beine zu stellen. „Die Idee dahinter war es, gemäß dem Wunsch vieler Akteure, den Golfsport und seine Anlagen etwas offener für die Bevölkerung zu halten, um zu zeigen, dass Golf nicht immer nur elitär sein muss. Diese Idee verband man mit dem Wunsch, dabei auch etwas Gutes für goolkids zu tun“, erinnert sich Herr Bartsch. Gesagt, getan, die Premierenveranstaltung zeigte den gewünschten Erfolg. Nach dem Golfen inklusive Rahmenprogramm gab es ein gemütliches Beisammensein umrahmt von Showgrillen und Musik.
Im Zuge der Corona-Pandemie stand die diesjährige zweite Auflage unter besonderen Vorzeichen. Nach dem Lockdown im Frühjahr war die Planung schwierig. Dementsprechend war zunächst das Prinzip Hoffnung vorherrschend, wie Laura Stelzer betont. „Ein Benefiztag sollte ja nicht nur den Golfern, sondern auch den Besuchern Spaß machen. Dies schien im Frühjahr noch undenkbar. Wir mussten dann den Termin um drei Monate nach hinten verlegen. Aber für uns war es wichtig, dennoch ein Projekt dieses Jahr stattfinden zu lassen.“


Günter Lückemeier (links) von Hauptsponsor BKM-Mannesmann und Benedikt Zenglein von der Golfanlage Gut Leimershof nahmen gemeinsam die Siegerehrung vor
Golfen sehr gut, Rahmenprogramm regenbedingt nur eingeschränkt möglich
Um die Hygienemaßnahmen einzuhalten, wurde im Vergleich zum Vorjahr Personal aufgestockt. „Wir brauchten Kennzeichnungen für Wegabläufe, Maskenpflicht, Abstand halten und Gästeregistrierung am Eingang. All dies ist ja aktuell gang und gäbe. Dadurch, dass das Golfturnier im Außenbereich stattfand, konnte jedoch darauf gut geachtet werden“, so Herr Bartsch. Da diesmal das Turnier erst im Herbst stattfand, wurde ein Zelt aufgebaut, das vom Hauptsponsor der Veranstaltung organisiert wurde, Heizpilze und warme Getränke halfen zusätzlich.
„Kommen denn auch wirklich alle gemeldeten Spieler? Und kommen überhaupt Gäste mit Kindern?“ Diese Fragen gingen Herrn Bartsch durch den Kopf, als er am Samstagmorgen bei leichtem Regen von Bamberg gen Leimershof fuhr. Und letzten Endes unterscheidet er beim Resumee. „Golf lief sehr gut. Bei der Zahl der aktiven Golfer wurden wir sogar sehr positiv überrascht. Trotz schlechten Wetters gab es deutlich mehr Aktive als Voranmeldungen. Was die Information über unsere Projekte betrifft, so waren persönliche Gespräche leider nur begrenzt durchführbar. Da fehlten uns die Begegnungen in kleinen Gruppen. Wir hätten auch gerne mehr Kinder mit Familien sowie Menschen mit Behinderung angesprochen, um miteinander einen schönen Tag zu erleben. Leider war uns dies durch die aktuelle Lage nicht möglich.“
Dies ist besonders schade, weil goolkids diesmal im Vergleich zur Premiere für ein Kinderprogramm in Form einer Spielewiese mit vielen kostenlosen Aktionen sowie für Begegnungsorte für Menschen mit Behinderung gesorgt hatte.
Insgesamt zeigen sich die Verantwortlich jedoch sehr zufrieden, nicht nur wegen des hohen zusammengekommenen Erlöses. „Zu sehen, wie trotz der schlechten Wetterlage so viele Golfer Spaß hatten und den Tag genießen konnten“ sei sein persönliches Highlight an diesem Tag gewesen, so Robert Bartsch.
Aktuell treiben den Förderverein Fragen um, wie er trotz der aktuellen Situation weiterhin für seine Schützlinge da sein kann, ob Projekte gestartet werden können, in Kleingruppen oder sogar digital, und welche Hilfsangebote möglich sind bei einem Weihnachten unter Distanzregeln. „Zusätzlich haben wir bei ginaS eine neue barrierefreie Website entwickelt, die für mehr Informationsaustausch untereinander sorgen soll“, berichtet Laura Stelzer.
Und auch einen Termin für das dritte Benefizgolfturnier gibt es bereits. „Es gibt eine Neuauflage, die schon für den 12. Juni kommenden Jahres festgelegt wurde“, so Laura Stelzer. „Wir hoffen auf einen sonnigen Tag, mehr Begegnungen, ein eingedämmtes Corona und viele freudige Gesichter, die nicht nur auf dem Golfplatz zu sehen sind.”
Weitere Informationen rund um ginaS unter http://www.ginas.net