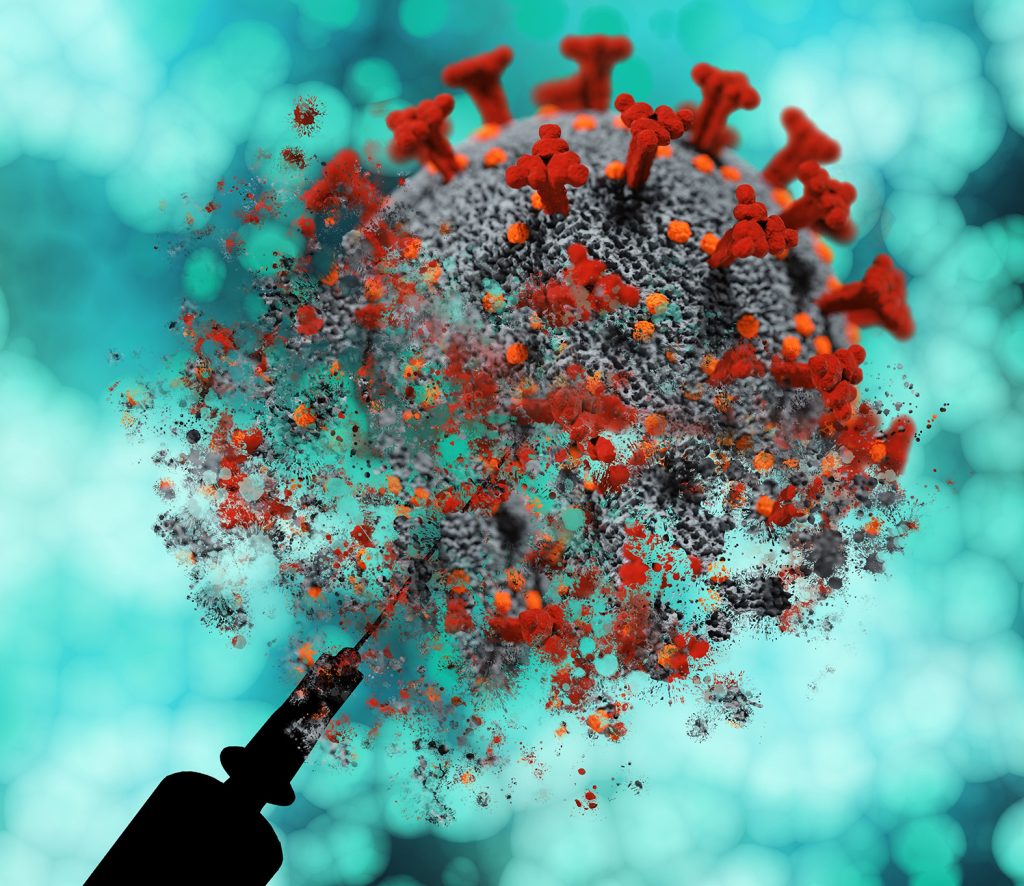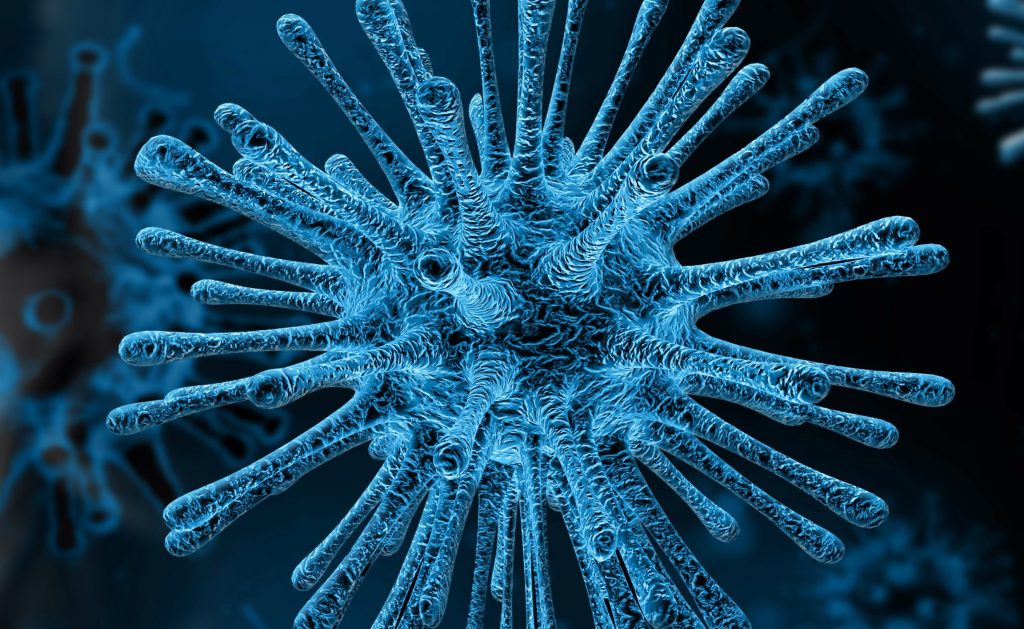Netzwerktreffen am 1. März in München
Verbesserung der Versorgung von Post- und Long-COVID-Betroffenen
Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek will die Versorgung von Menschen, die von Langzeitfolgen einer Corona-Infektion betroffen sind, weiter verbessern. Für den 1. März hat Holetschek die Expertinnen und Experten der Förderprojekte der bayerischen Initiative „Versorgungsforschung zum Post-COVID-Syndrom“ zum zweiten Netzwerktreffen nach München eingeladen.
„In Bayern wurden laut Kassenärztlicher Vereinigung Bayerns in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres mehr als 350.000 Menschen mit der Diagnose Post- oder Long-COVID-Syndrom ambulant erstversorgt“, betonte Holetschek am Sonntag. „Im gesamten Jahr 2021 waren es rund 150.000. Viele der Betroffenen müssen längerfristig weiterversorgt werden.“
Holetschek ergänzte, die Betroffenen litten unter krankhafter Erschöpfung, Atemnot, Konzentrations‑, Wortfindungs- und Gedächtnisstörungen. Einfachste Alltagsaktivitäten wie Einkaufen, Spazieren gehen und Duschen fielen schwer.
Der Begriff Long-COVID umfasst Symptome, die mehr als vier Wochen nach der Ansteckung fortbestehen, sich verschlechtern oder neu auftreten. Als Post-COVID-Syndrom werden im Unterschied dazu Symptome bezeichnet, die sich während oder nach einer COVID-19-Erkrankung entwickeln, länger als zwölf Wochen andauern und nicht durch eine alternative Diagnose erklärt werden können. Als Corona-Langzeitfolgen werden inzwischen mehr als 200 mögliche Symptome beschrieben.
Der Minister erläuterte, Bayern habe bereits 2021 eine Förderinitiative aufgelegt, mit der der Freistaat die Forschung zu einer besseren Versorgung von Post- und Long-COVID-Erkrankten unterstütze. „Die sieben Projekte umfassen alle Altersgruppen sowie Aspekte der Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Dafür haben wir fünf Millionen Euro bereitgestellt, als bundesweit noch niemand in dieser Richtung aktiv war.“
Mit dem Netzwerktreffen wolle Bayern die Akteure noch enger miteinander vernetzen. Der Freistaat wolle damit auch den Wissenstransfer zwischen den verschiedenen Akteuren in Bayern – Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft, der Leistungserbringer, der Kostenträger – und den Betroffenen stärken. Nur so könne die Versorgung nachhaltig weiter verbessert und könnten Hürden für die Betroffenen weiter abgebaut werden.
Aktuell geförderte Projekte
- Das Projekt „Post-COVID Kids Bavaria“ besteht aus zwei eigenständigen Projekten und befasst sich mit Langzeiteffekten von Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen.
- Schwerpunkt des Projekts „Post-COVIDLMU“ ist die interdisziplinäre und sektorenübergreifenden Behandlung und Erforschung von komplexen und schweren Fällen des Post-COVID-Syndroms bei Erwachsenen.
- Das Projekt „disCOVer“ hat sich die Entwicklung eines diagnostischen Algorithmus zur Klassifikation von Post-COVID-Patientinnen und ‑Patienten zum Ziel gesetzt. Basis hierfür bilden objektive Parameter, anhand derer Patientinnen und Patienten in eine von drei postulierten Subgruppen eingeteilt werden.
- Ziel ist des Projekts „ReLoAd after COVID-19-Study“ ist es zu erforschen, welche Auswirkung ein nach dem jeweiligen Hauptsymptom ausgerichtetes Rehabilitationsprogramm auf die Lebensqualität von Post-COVID-Patienten und ‑Patientinnen besitzt.
- Die Entwicklung eines Behandlungspfads für Erwachsene im Erwerbsalter, der aufeinander aufbauende bzw. komplementäre, sektoren- und disziplinübergreifende Versorgungskomponenten umfasst, ist Inhalt des Projekts „ASAP“.
- Mit der Verbesserung und Erforschung der gesundheitlichen Situation von Post-COVID-Patientinnen und ‑Patienten anhand eines integrativ-naturheilkundlichen Versorgungskonzeptes befasst sich das Projekt „Integrative Medizin und Naturheilkunde in der Behandlung des Post-COVID-Syndroms“
Weltkrebstag
Holetschek ruft zu Vorsorge auf
Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat zum gestrigen Weltkrebstag zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen aufgerufen. Er betonte, wichtige Angebote zur Krebsfrüherkennung sollten genutzt und der Lebensstil gesundheitsförderlich geführt werden.
„Niemand sollte aus Angst vor möglichen Diagnosen eine Untersuchung scheuen. Denn viele Krebsarten sind heilbar, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Deswegen sind Früherkennungsuntersuchungen für jeden wichtig. Vorsorge ist die beste Versicherung“, sagte Klaus Holetschek.
Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Für 2019 wurden im bayerischen Krebsregister für den Freistaat 68.760 Neuerkrankungen gemeldet, davon 36.834 (rund 54 Prozent) bei Männern und 31.914 (rund 46 Prozent) bei Frauen, wie das Gesundheitsministerium berichtet (Meldungs-Stand 31. Dezember 2022). Die häufigste Krebsart war demnach Brustkrebs (10.503 Fälle), gefolgt von Prostatakrebs (9.637), Darmkrebs (8.431) und Lungenkrebs (6.016).
„Die Zahlen sind weiterhin hoch, aber wir erkennen einen positiven Trend“, erläuterte Holetschek. „Im Jahr 2014 waren noch 571 Personen von 100.000 Einwohnern in Bayern von einer bösartigen Krebserkrankung betroffen. Für das Jahr 2019 wurden trotz der demografischen Entwicklung nur noch 555 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert.“
Wer gesund lebt, mindert sein persönliches Risiko
Der Minister erklärte, es gebe viele Angebote zur Krebsfrüherkennung. Sie umfasse Brustkrebs (klinische Untersuchung der Brust ab 30 Jahren, Mammographie-Screening ab 50 Jahren), Darmkrebs (ab 50 Jahren), Gebärmutterhalskrebs (ab 20 Jahren), Hautkrebs (ab 35 Jahren) und Prostatakrebs (ab 45 Jahren).
Ebenfalls wichtig sei ein gesundheitsförderlicher Lebensstil. Wer gesund lebe, mindere sein persönliches Risiko für Krebs oder andere Krankheiten, betonte Holetschek. „Nicht rauchen, genügend körperliche Aktivität und Bewegung, ausgewogene Ernährung, wenig Alkohol, Übergewicht vermeiden – das sind Dinge, auf die jeder im Alltag achten kann und die vorbeugend wirken. Experten zufolge kann etwa die Hälfte aller Krebsfälle durch einen gesünderen Lebensstil vermieden werden.“
Im Rahmen der Initiative „Gesund.Leben.Bayern.“ fördert das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wegweisende Modell-Projekte für Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Potenzial der bayernweiten Anwendung und will so zu einem gesundheitsbewussten Lebensstil motivieren. Das laufende Projekt „CCC München macht Schule digital – Digitale Vermittlung von Gesundheitskompetenz zur Prävention von Krebserkrankungen an Schülerinnen und Schüler“ des Klinikums der Universität München – Comprehensive Care Center (CCC) soll Schülerinnen und Schülern Wissen zur Krebsprävention vermitteln. Das Modellprojekt beinhaltet die Durchführung von insgesamt zwölf Projekttagen in verschiedenen Klassenstufen und Schularten anhand eines digitalen Lernkonzepts zu Themen wie „Krebsprävention durch Ernährung und Bewegung sowie praktische Umsetzung“ oder „Krebsprävention durch medizinische und umweltbedingte Maßnahmen“ in interdisziplinären Arbeitsgruppen unter Beteiligung von Schülern, Lehrern, Medizinern, Psychologen, Sportmedizinern oder Ernährungswissenschaftlern.
Wie das Gesundheitsministerium weiterhin mitteilt, werden Krebserkrankungen seit 1998 im bayerischen Krebsregister erfasst. Dieses wird seit 2017 in erweiterter Form vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit geführt. Ziel ist es, die klinische Versorgung von Patientinnen und Patienten in den Regionen zu optimieren, Über- und Unterversorgung vorzubeugen und etwaige epidemiologische Häufungen abzuklären.
Ab 1. Januar übernehmen Arztpraxen und Apotheken
Holetschek: „Impfzentren waren ein großer Erfolg“
Ab dem 1. Januar übernehmen die Arztpraxen und die Apotheken komplett die Corona-Schutzimpfungen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat bei einem Besuch des Impfzentrums in Kempten im Allgäu eine positive Schlussbilanz der Arbeit der Corona-Impfzentren im Freistaat gezogen. Er betonte zugleich, dass Impfen ein zentrales Mittel im Kampf gegen Corona bleibe.
„In Bayern übernehmen ab dem 1. Januar 2023 die Arztpraxen, die Betriebsärzte und Apotheken komplett die Corona-Schutzimpfungen. Klar ist dabei: Die Impfzentren waren ein großer Erfolg und ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie“, betonte der Minister heute in Kempten.
Holetschek erläuterte, es habe insgesamt in Bayern bislang knapp 29 Millionen Corona-Impfungen gegeben, von denen rund 14,3 Millionen Impfungen (Stand: 28.12.2022) in den Impfzentren und durch mobile Teams verabreicht worden seien. Mit ihrem Einsatz sei es möglich gewesen, die Impfungen je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs in allen Regionen Bayerns anzubieten. „Ich danke den Teams vor Ort, den Kommunen, den Rettungskräften, den Hilfsorganisationen wie beispielsweise in Kempten dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) und allen, die im Zusammenhang mit den Impfzentren im Einsatz waren. Ohne sie wäre der Impfbetrieb nicht möglich gewesen.“
Die Präsidentin des BRK, Angelika Schorer, betonte, der Einsatz der vielen Tausend Ehren- und Hauptamtlichen aus dem Bayerischen Roten Kreuz und weiteren Hilfsorganisationen sei elementar gewesen, um diese Impfkampagne mit Leben zu füllen. „Zu Spitzenzeiten hatten wir wöchentlich mehr als 1.500 hauptamtliche und 400 ehrenamtliche Mitarbeitende im Einsatz.“
Zu Spitzenzeiten habe es in Bayern 100 Impfzentren gegeben, ergänzte Holetschek. Zuletzt seien noch rund 80 Impfzentren und Außenstellen mit mobilen Teams im Freistaat aktiv gewesen, die die Regelversorgung ergänzten. Schon seit dem 1. Dezember diesen Jahres seien erste Impfzentren abgebaut worden. Nun übernehmen die niedergelassenen Haus- und Fachärzte, aber auch die Betriebsärzte und die Apotheken die COVID-19-Schutzimpfungen ab dem 1. Januar 2023 komplett.
„Impfen bleibt ein zentrales Mittel im Kampf gegen Corona“
„Fast genau vor zwei Jahren, am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020, erhielt Bayern die ersten 9.750 Impfdosen. Die mussten für einige Tage und für den ganzen Freistaat reichen“, blickte Holetschek zurück. „Damals mussten die Impfzentren in Windeseile aus dem Boden gestampft werden. Auch mobile Teams wurden sehr rasch gebildet. Das konnte nur gelingen, weil alle Beteiligten an einem Strang gezogen haben – mit einem Ziel: den lebensrettenden Impfstoff so rasch wie möglich zu verimpfen. Eine Riesenaufgabe – und die haben alle gemeinsam mit Bravour gemeistert.“
Im Rückblick seien es nach seiner Ansicht zwei Impfjahre voller Herausforderungen gewesen. Zunächst sei aufgrund des knappen Impfstoffs nötig gewesen zu priorisieren, um diejenigen zuerst zu impfen, die im Falle einer Infektion am stärksten gefährdet waren. Ein Erfolg der Impfzentren und Impfkampagne sei gewesen, dass gerade die vulnerablen Gruppen rasch erreicht wurden. Und wichtig sei auch gewesen, dass das medizinische oder pflegerische Personal schnell geimpft werden konnte.
„Das Impfen bleibt ein zentrales Mittel im Kampf gegen Corona“, betonte Holetschek. Es biete den besten Schutz für jeden Einzelnen vor einem schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung. Daher appelliere er an alle, ihren Impfstatus mit ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin zu überprüfen und eine gegebenenfalls erforderliche Auffrischungsimpfung vornehmen zu lassen.
Wer sich noch nicht für eine Corona-Impfung entschieden habe, solle mit der Medizinerin oder dem Mediziner seines Vertrauens über die Vorteile einer Impfung sprechen. Denn klar sei: Corona wird bleiben. „Insofern ist es nur folgerichtig, dass die Impfungen in die Regelversorgung übergehen. Ärztinnen und Ärzte sowie das Fachpersonal in den Praxen, die seit mehr als eineinhalb Jahren wesentlicher Bestandteil der Impfkampagne waren, Apotheken wie Betriebsärzte haben großartige Arbeit geleistet und werden dies auch weiterhin tun.“
Der Minister betonte ferner, aus der Pandemie müssten Lehren gezogen werden, Wissenschaft und Politik müssten sich intensiv mit den Impf-Erfahrungen während der Corona-Pandemie beschäftigen. Für eine sinnvolle Maßnahme hält Holetschek die Einrichtung von Impfregistern.
Neues digitales Suchtberatungsangebot
DigiSucht soll 2023 flächendeckend in Bayern verfügbar sein
Am Montag startete bundesweit eine neue Online-Suchtberatungsplattform. DigiSucht soll bei Fragen und Problemen zum Thema Sucht anhand der Anonymität des Internets einen besonders niedrigschwelligen Zugang bieten und ab 2023 flächendeckend in Bayern verfügbar sein.
Das digitale Hilfsangebot DigiSucht richtet sich an suchtgefährdete und suchtkranke Menschen und deren Angehörige. Das gab das Bayerische Gesundheitsministerium am 17. Oktober bekannt. Unabhängig von der Art des Suchtproblems könne man die Plattform auch nur zu Beratungszwecken nutzen. Auch hybride Beratungskonzepte aus digitaler und analoger Beratung vor Ort (sogenanntes Blended Counseling) seien möglich. Im geschützten und anonymen Bereich der Plattform bestehe außerdem die Möglichkeit, sich allgemein zum Thema Sucht zu informieren und anonyme Selbsttests zum eigenen Konsumverhalten vorzunehmen.
Per E‑Mail oder in Text- und Video-Chats können Betroffene sowie Angehörige mit professionellen Suchtberaterinnen und ‑beratern der Psychosozialen Suchtberatungsstellen (PSBen) in Kontakt treten. Neben der Übermittlung von Nachrichten kann man auch Termine für einen direkten Austausch per Text- oder Video-Chat buchen.
Laut Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bietet DigiSucht noch Zusätzliches. „Digitale Tools wie das Konsumtagebuch oder ein Notfallkoffer mit konkreten Handlungsstrategien zur Bewältigung von Rückfällen können die Ratsuchenden bei Verhaltensänderungen in vielfältiger Weise unterstützen. Sie erweitern die Möglichkeiten der ambulanten Suchtberatung, indem sie den Beratungsprozess strukturieren und die Betroffenen auch außerhalb der persönlichen Beratungsgespräche begleiten.“
Dabei spiele die Erweiterung bestehender analoger Beratungsangebote um die Möglichkeit der Online-Suchtberatung eine entscheidende Rolle. Mit DigiSucht stelle Bayern den PSBen trägerübergreifend die notwendige Infrastruktur zur Verfügung.
Modellberatungsstellen
In Bayern werden zunächst drei Modellberatungsstellen teilnehmen. Dazu gehören die Mudra in Nürnberg, die kommunale Jugend- und Drogenberatung in Würzburg und die Fachambulanz für Suchterkrankungen im Caritas-Zentrum Ebersberg in Grafing. Unabhängig von der Art des Suchtproblems ist eine digitale Beratung an allen drei Beratungsstellen möglich. Es gibt aber gewisse Schwerpunkte. So verfügt die Suchtberatungsstelle der Caritas in Grafing etwa über eine Fachambulanz zum Thema Glücksspielsucht.
Holetschek kündigte an: „Bereits im Januar 2023 werden in Bayern sieben weitere Modellberatungsstellen hinzukommen. Flächendeckend soll DigiSucht im ganzen Freistaat mit seinen 110 PSBen ab dem zweiten Quartal 2023 ausgerollt werden. Die Kosten für die notwendigen Mitarbeiterschulungen trägt der Freistaat. Unser Ziel ist es, dass in naher Zukunft Online-Suchtberatung ein reguläres Angebot jeder PSB in Bayern wird. Insbesondere wollen wir junge internetaffine Menschen künftig besser erreichen.“
Das könnte Sie auch interessieren...
Kurzzeit-Pflegeplätze
Förderbescheid für Haßberg-Kliniken
Bayern investiert in den Ausbau von Kurzzeit-Pflegeplätzen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek übergab dazu einen Förderbescheid über 1,96 Millionen Euro an die Haßberg-Kliniken in Unterfranken.
Bayern versucht, sein Angebot an Kurzzeitpflegeplätzen weiter auszubauen. Wie das Ministerium am 8. September bekanntgab, hat Gesundheitsminister Klaus Holetschek im unterfränkischen Ebern dafür einen Förderbescheid an die Haßberg-Kliniken übergeben.
Holetschek sagte: „Wir werden immer älter. Die Wahrscheinlichkeit, eines Tages pflegebedürftig zu werden oder an Demenz zu erkranken, steigt. Darauf müssen wir vorbreitet sein und individuelle Angebote für Menschen mit Pflegebedarf entwickeln. Denn die meisten Menschen wollen möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Im Haus Ebern sollen 28 Plätze entstehen. Ich freue mich, dass wir die Haßberg-Kliniken mit 1,96 Millionen Euro aus unserem Förderprogramm PflegesoNah unterstützen können.“
Des Weiteren sei es auch für die Hassberg-Kliniken nicht unerheblich, Patientinnen und Patienten zeitnah an die stationäre Versorgung in der Kurzzeitpflege zu heranzuführen, bis ein Pflegeplatz gefunden ist. Gleichermaßen könnten pflegende Angehörige, wenn sie einmal verhindert sind, die Kurzzeitpflegeplätze in Ebern für die zu Pflegenden nutzen.
„Das ist für die Bevölkerung des Landkreises ein dringend benötigtes Angebot, das hoffentlich bald in die Umsetzung kommt”, sagte Bernd Hirtreiter, stellvertretender Vorstand der Hassberg-Kliniken.
PflegesoNah
Die Investitionskostenförderrichtlinie „PflegesoNah“ existiert seit Ende 2019. Sie verfolgt das Ziel, in Bayern eine bedarfsgerechte, flächendeckende, regional ausgerichtete, demenzsensible und barrierefreie pflegerische Versorgungsstruktur weiter auszubauen.
Corona-Pandemie
Holetschek wirbt für zweite Auffrischimpfung
Das bayerische Gesundheitsministerium hat eine Kommunikationskampagne begonnen, die für die zweite Auffrischimpfung gegen Corona wirbt. Ziel der Kampagne ist ebenfalls, Impfskepsis auszuräumen.
Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat am Dienstag eine Kommunikationskampagne zur Auffrischimpfung gegen Corona gestartet. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Holetschek sagte bei den Vorbereitungen für Herbst und Winter dürfe die zweite Booster-Impfung nicht fehlen. „Sie ist nach wie vor der beste Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf von COVID-19. Je höher der Impfschutz in der Bevölkerung ist, desto besser starten wir in den Herbst und Winter. Das schützt unser Gesundheitssystem, vor allem aber die Menschen selbst.“
Dafür sei es wichtig, bereits jetzt über die Auffrischungsimpfung zu informieren und insbesondere bei den Risikogruppen dafür zu werben. Die neue Kampagne „Na Sicher“ setze genau da an. „Unser Ziel ist es“, sagte Holetschek, „Impfskepsis auszuräumen. Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger umfassend darüber aufklären, wo und warum sie sich ein weiteres Mal impfen lassen sollten.“
Die Ständige Impfkommission (STIKO) legt die erste Auffrischimpfung aktuell allen Menschen ab zwölf Jahren nahe. Auch Kindern ab fünf Jahren mit Vorerkrankungen oder Immundefizienz empfiehlt die Kommission die Auffrischung.
Den zweiten Booster empfiehlt die STIKO seit dem 18. August Personen ab 60 und ab fünf Jahren, wenn ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe besteht. Unverändert rät die Kommission Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen die Auffrischung. Dies gilt auch für das Personal von medizinischen Einrichtungen.
Holetschek stimmte den neuen Empfehlungen der Impfkommission zu. „Dass die STIKO jetzt die zweite Auffrischungsimpfung bereits für Menschen ab 60 Jahren empfiehlt, ist ein wichtiger Schritt. Dadurch sind wir in Deutschland im Gleichklang mit den Empfehlungen auf EU-Ebene.“ Außerdem könne man sich die Corona-Impfung zeitgleich mit der Impfung gegen Grippe geben lassen und so zwei Fliegen mit eine Klappe schlagen.
Dank für Engagement in der Pandemie
Neue Impfkampagne in stationären Pflegeeinrichtungen gestartet
Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek hat eine neue Impfkampagne in den stationären Pflegeeinrichtungen für die zweite Corona-Auffrischungsimpfung gestartet. Er dankte in diesem Zusammenhang auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegeeinrichtungen für ihr Engagement in der Pandemie.
Holetschek betonte am Montag aus diesem Anlass, dass auch wenn der Gipfel der Sommerwelle überschritten scheine die Infektionszahlen im Freistaat nach wie vor hoch seien und noch immer Menschen an oder mit Corona sterben. Gerade bei vulnerablen Gruppen sei die zweite Auffrischungsimpfung sehr wichtig, da mit zunehmendem Abstand zur ersten Auffrischungsimpfung die Schutzwirkung gegen schwere COVID-19-Verläufe abnimmt.
„Aktuell leben in Bayern rund 130.000 Menschen in über 1.600 Pflegeeinrichtungen. Unter den pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner haben viele die zweite Auffrischungsimpfung gegen Corona noch nicht erhalten – und sind damit nicht bestmöglich gegen das Virus geschützt. Das müssen wir ändern“, so Holetschek.
Das Bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium wirbt daher in den stationären Pflegeeinrichtungen verstärkt für die zweite Auffrischungsimpfung. Holetschek erläuterte, dass Ziel sei es, sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner als auch die Pflegekräfte in den Einrichtungen zur vierten Impfung zu bewegen. Die Expertinnen und Experten seien sich einig: Wer zu einer Risikogruppe gehöre, solle sich ein viertes Mal impfen lassen und nicht auf die angepassten Impfstoffe warten. „Ich appelliere daher an die Bewohnerinnen und Bewohner in den Einrichtungen: Holen Sie sich jetzt die zweite Auffrischungsimpfung!“
Der Minister erläuterte, das Ministerium stelle den Pflegeeinrichtungen Informationsmaterial zur Verfügung, das die Vorteile der Impfung kurz und knapp erläutert. „Wir sprechen dabei nicht nur die Pflegekräfte und die Pflegebedürftigen an, sondern auch die Angehörigen. Auf der Webseite des Gesundheitsministeriums stellen wir die Informationsmaterialien zudem künftig auch in Albanisch, Bosnisch, Englisch, Kroatisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch und in leichter Sprache zur Verfügung.“
Holetschek dankte zugleich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegeeinrichtungen für ihr herausragendes Engagement in der Pandemie. „Sie leisten bei der Bewältigung der Corona-Pandemie Großartiges“, betonte der Minister. „Danke, dass Sie sich tagtäglich für das Wohl der Menschen einsetzen, die Ihnen anvertraut wurden. Bitte unterstützen Sie uns auch jetzt: Sprechen Sie mit den Pflegebedürftigen über das Impfangebot und unterstützen Sie sie bei der Organisation eines Impftermins.“
Weitere Informationen zur Kampagne sind hier zu finden.
Neuer Gesundheitsreport Bayern liegt vor
Holetschek pocht auf umfassende Pflegereform
Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek pocht darauf, dass die Bundesregierung die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Langzeitpflege umfassend reformiert und damit auch mehr Personal ermöglicht.
Holetschek betonte am Sonntag anlässlich der Veröffentlichung des neuen Gesundheitsreports Bayern des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL): „Die Langzeitpflege ist eine der großen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte. Schon jetzt ist die Personalsituation in der Pflege angespannt – und wir wissen, dass sich die Lage noch weiter zuspitzen wird. Das verdeutlicht auch der neue LGL-Report. Deshalb muss die Bundesregierung rasch handeln. Angesichts der stark steigenden Zahl an Pflegebedürftigen ist auch eine Struktur- und Finanzreform der Pflegeversicherung unerlässlich.“
Der Gesundheitsreport 2/2022 des LGL befasst sich ausführlich mit den Trends in der Altenpflege und gibt einen allgemeinverständlichen Überblick über die Situation. Darin enthalten sind auch die aktuellsten Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik (LfStat) aus dem Jahr 2019. „2019 gab es im Freistaat 491.996 Pflegebedürftige. Davon waren mehr als 400.000 Menschen älter als 65 Jahre“, erläuterte der Minister. „Und wir wissen, dass die bayerische Bevölkerung immer älter wird. Im Jahr 2040 wird mehr als ein Viertel der Bevölkerung älter als 65 Jahre sein. Da mit zunehmendem Alter das Risiko steigt, pflegebedürftig zu werden, wird auch die Zahl der Pflegebedürftigen weiter wachsen.“
Corona-Pandemie war eine starke psychische Belastung
Damit steige, wie Holetschek ergänzte, der Bedarf an Pflegekräften. Ein Gutachten des Gesundheitsministeriums im vergangenen Jahr habe deutlich gemacht, dass die Pflegekapazitäten in der Hälfte aller bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte um gut 50 Prozent aufgestockt werden müssten, um der pflegerische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger weiter gerecht zu werden. Das seien rund 19.600 Pflegefachkräfte und rund 19.200 Hilfskräfte in Vollzeit mehr bis zum Jahr 2040.
Neben der Pflegebedarfsprognose befasst sich der Gesundheitsreport Bayern 2/2022 unter anderem auch mit den Folgen der Corona-Pandemie für die Pflegebedürftigen. Demzufolge wurde über die Hälfte der COVID-19-Sterbefälle in Deutschland von einem ambulanten Pflegedienst versorgt oder lebte in einer stationären Pflegeeinrichtung. Der Bericht verweist auch auf den bayerischen ambulanten COVID-19 Monitor (BaCoM). Die bereits bekannten Zwischenergebnisse der Studie verdeutlichen, dass die Corona-Pandemie eine starke psychische Belastung für Pflegebedürftige wie auch für pflegende Angehörige war und ist. Daneben beleuchtet der Report auch die pflegerische Versorgung sowie Präventionsangebote im Freistaat.
„Die Pflege für die Zukunft aufzustellen, ist eine Mammutaufgabe, die wir jetzt angehen müssen! Wir müssen unsere Anstrengungen darauf richten, die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege zu halten und gleichzeitig mehr Beschäftigte für den Pflegeberuf zu gewinnen“, betonte Holetschek. „Klar ist: Nur zufriedene Pflegekräfte können dafür sorgen, dass sich die Pflegebedürftigen wohlfühlen.“
Er erläuterte, die Weichen für attraktivere Rahmenbedingungen des Pflegeberufs müssten jetzt gestellt werden. Er habe schon vor weit mehr als einem Jahr Eckpunkte für eine zukunftsfeste Pflegereform vorgelegt. „Klar ist: Es muss die gesamtgesellschaftliche Bereitschaft bestehen, mehr Geld in die pflegerische Versorgung zu investieren! Insbesondere versicherungsfremde Leistungen der Pflegeversicherung müssen über Steuern refinanziert werden.“ Bayern habe eine Bundesratsinitiative eingebracht, um etwa Zuschläge für Wochenend- und Nachtarbeit sowie Überstunden weiter als bisher steuerlich zu begünstigen. Der Bund müsse nach Worten Holetscheks jetzt handeln.
„Für mich ist klar: Qualifizierte Fachkräfte in der Pflege zu halten und neue zu gewinnen, ist eine zentrale Aufgabe einer zukunftsfähigen Pflegepolitik. Attraktive Arbeitsbedingungen sind flächendeckend nur in einem solide finanzierten und deutlich vereinfachten System zu erreichen“, betonte der Minister. „Die Bundesregierung darf das Thema nicht auf die lange Bank schieben. Der Reformbedarf ist groß – und die Zeit drängt. Ziel einer Pflegereform muss es sein, konsequent zu vereinfachen, zu flexibilisieren und zu entlasten! Wir können es uns nicht leisten, dass Pflegebedürftigen, Pflegekräften und Pflegeanbietern die Zeit fehlt, sich um die bestmögliche Versorgung zu kümmern, weil sie mit zu komplizierten Strukturen beschäftigt sind. Ich habe bereits im März 2021 Eckpunkte für eine zukunftsfeste Pflegereform vorgelegt. Hierzu gehören auch Steuerzuschüsse zur Pflegeversicherung, um die Leistungen auf Dauer stabil zu halten.“
Bayerns Gesundheitsminister rüstet auf
Impfbeauftragte für Alten- und Pflegeeinrichtungen
Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek will die Corona-Auffrischungsimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen vorantreiben, unter anderem sollen Impfbeauftragte unterstützen. Dazu äußerte er sich heute in München, wie das Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege mitteilt.
Angedacht sei, dass Impfbeauftragte in den Impfzentren die Alten- und Pflegeeinrichtungen zukünftig eng betreuen und sich gezielt um die erste oder zweite Auffrischungsimpfung der Bewohnerinnen und Bewohner kümmern. So solle erreicht werden, dass die Einrichtungen durch die Impfbeauftragten unterstützt und entlasten werden.
„Trotz unserer schon bisher intensiven Bemühungen ist die Quote der Auffrischungsimpfungen in den Einrichtungen – vor allem der vierten Impfung – noch nicht zufriedenstellend“, so Holetschek. „Gerade Risikogruppen sind durch eine zweite Auffrischungsimpfung gut vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt. Der Bund ist mit einem Gesetzesprojekt vorgeprescht, dass die Einrichtungen vor Probleme stellt in punkto Bürokratie und Finanzierung. Bayern geht jetzt mit einem eigenen Konzept in Vorleistung. Denn klar ist: Wir lassen die Einrichtungen bei dieser wichtigen Aufgabe nicht allein.“
„Wir wollen gut vorbereitet in den Herbst und Winter gehen!“
Holetschek erläuterte, die Regierung stehe in engem Austausch mit den Städten und Landkreisen sowie den Verbänden der Leistungserbringer. So habe das Ministerium nun die Impfzentren gebeten, Impfbeauftragte für Alten- und Pflegeheime zu ernennen, die als feste Ansprechpartner für die Einrichtungen dienen sollen. Geplant sei, dass sie die Arbeit der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte unterstützen und ergänzen, die in den Einrichtungen tätig sind und dort bereits Impfungen durchführen. Ab Mitte August sei geplant, dass Impfbeauftragte in Absprache mit den Verbänden in allen Einrichtungen der Pflege beispielsweise eine Beratungswoche anbieten. Ziel sei es, dass Impfbeauftragte vor Ort in die Einrichtungen gehen, mit Bewohnerinnen und Bewohnern sprechen, unbegründete Ängste nehmen und bei Bedarf über mobile Impfteams auch Impfungen organisieren.
„Auch unsere Impfkampagne ‚Na Sicher‘ richtet sich im Besonderen an Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen“, so Holetschek weiter. „Ab Mitte August werben wir dort verstärkt für die vierte Impfung. Schließlich empfiehlt die Ständige Impfkommission die zweite Auffrischungsimpfung unter anderen für Menschen ab 70 Jahren, für Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen der Pflege, für Personen mit einem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, für Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren und für Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen. Wir wollen gut vorbereitet in den Herbst und Winter gehen!“
Bayerischer ambulanter COVID-19-Monitor
Studie soll Daten und Analysen für künftige Krisen liefern
Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek hat anlässlich des Zwischenberichts der BaCom-Studie (Bayerischer ambulanter COVID-19-Monitor) auf die psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Pflegebedürftige und ihre Angehörigen hingewiesen.
„Die ersten Ergebnisse der Studie verdeutlichen nachdrücklich: Die Pandemie war und ist eine starke psychische Belastung für Pflegebedürftige wie auch für pflegende Angehörige“, sagte Holetschek heute in München.
Holetschek betonte, der Zwischenbericht zeige, dass Angehörige, die im häuslichen Umfeld pflegen, besonders gefordert gewesen seien, weil Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten wie Tageseinrichtungen, Kurzzeitpflege oder Ergotherapie ausfielen. Auf der anderen Seite hätten Angehörige von Pflegebedürftigen, die in stationären Einrichtungen leben, erlebt, dass die Kontaktbeschränkungen ihre Sorge um die Pflegebedürftigen verstärkten.
„Das Gefühl des Alleinseins hat bei Pflegebedürftigen mit und ohne COVID-Erkrankung im Vergleich zu vor der Pandemie deutlich zugenommen. Es sind die unterbrochenen Prozesse in den Familien, die die Pflegebedürftigen besonders beinträchtigen: Die vertrauten Beziehungen ändern sich, wenn sie nur noch über das Telefon gelebt werden können. Wichtige beratende Aufgaben einer Großelternschaft können nicht mehr übernommen werden und reduzieren die Teilhabe am Familienleben“, unterstrich Studienleiter Professor Jochen Gensichen, Direktor am Institut für Allgemeinmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), hinsichtlich der psychosozialen Auswirkungen auf die Pflegebedürftigen selbst.
Studie ermöglicht gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung
Der Bayerische ambulante COVID-19 Monitor (BaCoM) ist 2021 unter Federführung des Klinikums der LMU gestartet, um die psychischen, physischen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie bei Pflegebedürftigen und Angehörigen in der ambulanten und stationären Langzeitpflege Bayerns umfassend und interdisziplinär zu untersuchen.
„Der Bayerische ambulante Covid-19 Monitor soll entscheidungsrelevante Daten und Analysen für bevorstehende Pandemien oder vergleichbare Krisensituationen liefern“, erläuterte Klaus Holetschek. Hierfür sammelt und analysiert die Studie unter anderem Daten zu gesundheitlichen Folgen der Covid-19-Pandemie wie Long-COVID oder Depression sowie deren Risikofaktoren. So sollen gezielt passende Präventions- und Nachsorgestrategien in die Wege geleitet werden können, zum Beispiel eine Anbindung Betroffener an Long-COVID-Ambulanzen oder an psychologische Betreuungs- und Therapieangebote.
Auch erfasst die Studie die Folgen psychischer und physischer Belastungen der versorgenden Pflegekräfte und Angehörigen – darunter Burnout und Depression – gemeinsam mit den Strukturmerkmalen der Pflegeeinrichtungen und Haushalte. „So können gezielt Versorgungsengpässe identifiziert und in der Folge konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung getroffen werden“, unterstrich der Minister. Auch Hausärztinnen und Hausärzte werden im Rahmen der Studie befragt. Das Bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium stellt dem Forschungsteam aus Pflegekräften, Hausärzten, Infektiologen und Soziologen Fördermittel in Höhe von 3,4 Millionen Euro bereit.
Neben dem LMU Klinikum München sind die Katholische Stiftungshochschule München sowie die Universitätskliniken in Würzburg und Erlangen an dem Projekt beteiligt. Im ersten Jahr haben sich insbesondere bereits fast 500 Pflegebedürftige, Leistungserbringer und Angehörige an der Studie beteiligt. Für den weiteren Verlauf der Studie werden noch zusätzliche Teilnehmer gesucht.