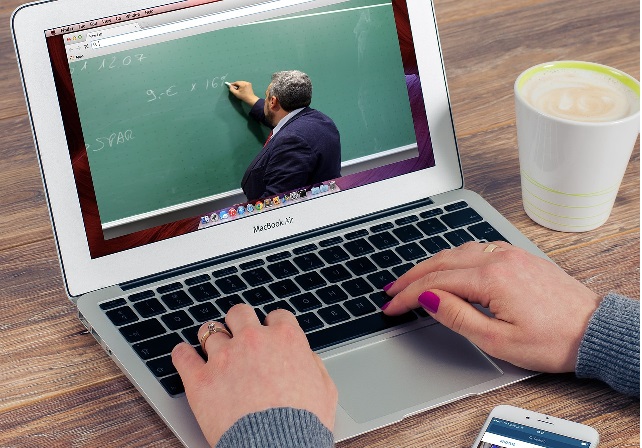Datengetriebene Besuchslenkung als Ziel
Smarte Sensoren an vollen Plätzen in Bamberg
Um Aufschluss darüber zu bekommen, wie voll es in Bamberg an manchen Plätzen wirklich ist und wie die Bambergerinnen und Bamberger eine Datenerfassung durch Sensoren wahrnehmen, wurde das Projekt „Crowdanym“ gestartet. Es soll eine Vorstudie zu einer anonymen Datenerfassung als Grundlage einer datengetriebenen Besuchslenkung in der Bamberger Altstadt sein, wie die Stadt Bamberg mitteilt.
Bamberg wird als Weltkulturerbestadt oft und gerne von Touristinnen und Touristen besucht. Nicht selten befinden sich dabei sehr viele Menschen gleichzeitig an bestimmten Orten, wie beispielsweise im Dom oder am Gabelmo und so entsteht eine ungleichmäßige Nutzung von touristischen oder gastronomischen Angeboten. Um eine Datengrundlage für diese Wahrnehmungen in Bamberg zu liefern, wurde das Projekt „Crowdanym“ gestartet – eine Vorstudie zu einer anonymen Datenerfassung als Grundlage einer datengetriebenen Besuchslenkung in der Bamberger Altstadt. Nun wurden erste Sensoren in der Domstadt angebracht, um zu untersuchen, ob und wie man an touristisch belebten Orten messen kann, wie viele Menschen sich dort aufhalten – und wie sich Besucherinnen und Besucher durch die Stadt bewegen.
Anonymisierte Messungen geben Informationen
Das Projekt werde über die Innovationsinitiative „mFUND“ des BMDV (Bundesministerium für Digitales und Verkehr) gefördert und ist in Bamberg ein Kooperationsprojekt der Otto-Friedrich-Universität und des Förderprogramms Smart City Bamberg. „Crowdanym“ wolle Lösungen unterstützen, die Besucherinnen und Besucher intelligent lenken und große Ansammlungen von Menschen vermeiden könnten. Eingesetzt würden dazu Sensoren, die bestimmte Handysignale aufnehmen und anonym an eine Auswertungsstelle weiterleiten. Dass sich hier keinerlei Sorgen um private Daten gemacht werden müsse, bekräftigt Prof. Dr. Daniela Nicklas, Lehrstuhlinhaberin für Informatik, insb. Mobile Softwaresysteme/Mobilität an der Uni Bamberg: „Durch die unmittelbare Anonymisierung werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert. Es wird also nur angezeigt, wie viele und nicht welche Personen sich derzeit zum Beispiel am Tourismus- und Kongressservice aufhalten. Das kommt zum einen den Anwohnerinnen und Anwohnern Bambergs zu Gute sowie künftig auch den Touristinnen und Touristen.“
Gemessen wird via Sensoren derzeit an der Oberen Brücke, auf dem Domplatz, am T&K‑Service, in der Sandstraße, am Maxplatz, am Grünen Markt und an der Konzerthalle. An allen Stellen befinden sich entsprechende Aushänge der Universität Bamberg, die Aufschluss über die Messung geben und darauf hinweisen, dass auch eine aktive Nicht-Teilnahme an der Messung möglich ist.
Vorprojekt zu einem künftigen Besuchsleitsystem
Mit den Informationen kann in Bamberg künftig ein Besuchsleitsystem aufgebaut werden, das nicht nur Touristinnen und Touristen helfen kann Großansammlungen zu umgehen, sondern auch bei Veranstaltungen wie der Sandkerwa oder Festen auf dem Maxplatz vor Überfüllung schützen könnte.
Wie stehen die Bambergerinnen und Bamberger zu den Sensoren?
„Uns ist es ein besonderes Anliegen aufzuklären und zu untersuchen, wie die Bambergerinnen und Bamberger eine solche Sensoren-Messung wahrnehmen. Deshalb werden wir aktiv Fragen stellen um herauszufinden, unter welchen Bedingungen die Bürgerschaft die Sensoren akzeptiert“, betont die Psychologin Prof. Dr. Astrid Schütz, die den Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik innehat.
Eine solche Befragung zur Akzeptanz von Sensoren habe bereits Anfang August an verschiedenen zentralen Stellen in der Bamberger Innenstadt stattgefunden.
Mehr Infos bei Smart City Research Lab-Projektmesse
Die Ergebnisse der Umfrage und mehr zu dem Projekt „Crowdanym“ sowie anderen Smart City-Projekten gebe es am Freitag, den 25. August bei der Projektmesse im neuen Digitalen Gründerzentrum, in der Nathan‑R.-Preston-Straße 1, zu erfahren, so die Stadt in der Meldung. Von 10 bis 13 Uhr würden an diesem Tag Projekte, die im Rahmen des Smart City Research Labs untersucht werden, von Studierenden präsentiert. Themen wie Mobilität, Klima und Digitale Gesundheitsdienste würden vertreten sein. Alle Interessierten seien herzlich eingeladen, sich zu informieren und Fragen zu den Projekten zu stellen. Eine Anmeldung sei nicht notwendig.
Stellungnahme der Bamberger Universitätsleitung
Solidarität mit der Ukraine
Die Leitung der Otto-Friedrich-Universität Bamberg hat sich in einer Stellungnahme zur Invasion der Ukraine durch Truppen der Russischen Föderation zu Wort gemeldet und diese verurteilt. Sie sei sich der Verwundbarkeit von Universitäten insgesamt, aber auch einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr bewusst. Die Universität werde versuchen, betroffene Studierende praktisch zu unterstützen.
„Wir lehnen völkerrechtswidrige Angriffe auf das Territorium eines Staates als Mittel der Politik ab und schließen uns den Forderungen der Bayerischen Staatsregierung nach einem sofortigen Ende der Invasion der Ukraine an.
Gewalt, die Missachtung nationalen und internationalen Rechts, insbesondere die Missachtung der Menschenrechte, der bürgerlichen Freiheiten und der Wissenschaftsfreiheit, stellten für das Wissenschaftssystem eine schwere Bedrohung dar, wie es weiter heißt. Wissenschaftlicher Fortschritt brauche Frieden, Rechtssicherheit und die Freiheit zum ungehinderten Austausch – ohne Ansehen askriptiver Merkmale wissenschaftlich Arbeitender und über staatliche Grenzen hinweg.
Universitäten müssen auch in schweren Zeiten ein Ort respektvollen Diskurses bleiben
„Als Leitung einer deutschen Universität sind wir uns der Verwundbarkeit von Universitäten insgesamt, aber auch einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr bewusst. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Sie sind aber auch bei den Studierenden und Mitarbeitenden aus der Ukraine an unserer Universität. Sie alle sind uns in diesen schweren Zeiten besonders nahe.“
Die Verantwortlichkeit für den Angriff auf die Ukraine liege bei der Regierung Russlands. Die Leitung solidarisiere sich mit dem offenen Brief von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Russland, die sich mutig und trotz eines zunehmend repressiven Staatsapparats gegen den Krieg aussprechen.
Weiter heißt es von Seite der Universitätsleitung, man trete jedem Versuch entgegen, Universitätsangehörige allein aufgrund ihrer russischen Herkunft anzufeinden. Universitäten müssten auch in schweren Zeiten ein Ort respektvollen Diskurses bleiben.
Die Universität Bamberg werde versuchen, betroffene Studierende praktisch zu unterstützen. „Nehmen Sie bei Problemen Kontakt zu den Mitarbeitenden des Akademischen Auslandsamts auf. Denken Sie an alle Beratungsmöglichkeiten der Universität und in der Stadt Bamberg. Dies schließt für Mitarbeitende die psychosoziale Beratungsstelle der Universität und für Studierende die psychotherapeutische Beratung des Studentenwerks sowie die Hochschulseelsorge ein. Sprechen Sie bitte auch mit Dozierenden Ihres Vertrauens, insbesondere wenn Ihre Studienleistungen zu leiden beginnen.“
Die Universität ist Mitglied von Scholars at Risk. Sie werde überregionale Initiativen zur Unterstützung ukrainischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau verfolgen. Sie werde sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten in relevante Maßnahmen einbringen. „Wenn möglich werden wir auch versuchen, bestehende Kooperationen mit ukrainischen Universitäten und Forschungseinrichtungen aufrechtzuerhalten und die Fakultäten und Institute der Universität auffordern, ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf bestehende Möglichkeiten für Gastdozenturen aufmerksam zu machen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität sind auch aufgefordert, Initiativen der jeweiligen Fachgesellschaften in der Universität bekannt zu machen und Möglichkeiten zur Beteiligung zu diskutieren.“
Das könnte Sie auch interessieren...
Studie
Digital kompetenter Unterricht – mangelhafte IT-Infrastruktur
Eine heute veröffentlichte deutschlandweite Studie unter Beteiligung der Universität Bamberg zeigt Stärken und Herausforderungen beim digitalen Unterrichten in der beruflichen Bildung auf. Dieser zufolge sind berufliche Lehrkräfte digital kompetent, allerdings mangelt es in Beruflichen Schulen häufig an einer stabilen IT-Infrastruktur.
Berufliche Lehrkräfte sind digital kompetent, arbeiten souverän mit digitalen Endgeräten und fühlen sich durch das digitale Unterrichten nicht außergewöhnlich gestresst. Ihre größte Herausforderung während der Pandemie: Häufig mangelt es in Beruflichen Schulen an einer stabilen IT-Infrastruktur, zum Beispiel einer guten WLAN-Verbindung. Zu diesen Erkenntnissen gelangt ein Forschungsteam in einer deutschlandweiten Studie, die am 21. Februar 2022 vom Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung e.V. (BvLB) veröffentlicht wurde. Für die Studie kooperierte ein Verbund mit Forschenden der Universitäten Bamberg, Hannover und Osnabrück sowie der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd.
Erste bundesweite Erhebung in Beruflichen Schulen
„Bei der Studie handelt es sich um die erste bundesweite Erhebung unter Lehrerinnen und Lehrern an Beruflichen Schulen zum Thema digitale Transformation“, betont der Sprecher des Forschungsteams Prof. Dr. Karl-Heinz Gerholz. Er hat die Professur für Wirtschaftspädagogik an der Universität Bamberg inne und ging mit seiner Kollegin Prof. Dr. Julia Gillen sowie den Kollegen Prof. Dr. Uwe Fasshauer und Prof. Dr. Thomas Bals in einer Umfrage insbesondere den Fragen nach: Wie kamen berufliche Lehrkräfte durch die Pandemie? Welche Potentiale sehen sie im digitalen Unterrichten und Organisieren? Und wie steht es um die digitale Kompetenz von beruflichen Lehrkräften? Für die Studie „Erfahrungen und Perspektiven des digitalen Unterrichtens und Entwickelns an beruflichen Schulen“ (Digi-BS) wurden 3.074 berufliche Lehrkräfte in Deutschland zwischen Dezember 2020 und März 2021 befragt.
„Die technische Infrastruktur ist ein Schlüsselfaktor, um die digitale Kompetenz von Lehrkräften weiter zu stärken und das subjektive Stresserleben zu reduzieren“, stellt Karl-Heinz Gerholz als zentrales Ergebnis der Studie heraus. Die Digi-BS-Studie zeigt, dass eine stabile und nachhaltige IT-Infrastruktur an den Schulen noch nicht in der Breite vorhanden ist, wie sie eigentlich benötigt wird. Insbesondere WLAN-Verfügbarkeit und ‑stabilität sowie Support und passgenaue Weiterbildungsangebote fehlen.
Pandemie hat digitale Ausstattung enorm beschleunigt
Davon abgesehen zeichnet die Studie ein eher positives Bild der digitalen Veränderung an Beruflichen Schulen: Die Pandemie hat die digitale Ausstattung, etwa mit Tablets und Laptops, enorm beschleunigt. Berufliche Lehrkräfte haben die Phasen des Distanzunterrichts und hybriden Unterrichtens erfolgreich gemeistert. Sie verfügen unter anderem über eine ausgeprägte digitale Kompetenz, sind neugierig hinsichtlich digitaler Technologien und können digitalen Unterricht insbesondere auch im Austausch mit dem Kollegium gut umsetzen. Unterstützung wird also wesentlich vor Ort in den Beruflichen Schulen erlebt, die der Bildungsverwaltung wird als eher begrenzt wahrgenommen. Diese positiven Erfahrungen im Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie, so der Mitautor Thomas Bals, „bestätigen erneut die Notwendigkeit einer umfassenden Autonomie der Beruflichen Schulen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages.“
Arbeit und Freizeit überschneiden sich zunehmend, was die befragten Lehrkräfte nicht als besonders belastend erleben. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass das Stresserleben normal ist. Es ist davon auszugehen, dass das digitale Arbeiten zwar manchmal mit Stressempfinden einhergeht, dieses allerdings nicht wesentlich negativer und belastender als üblich wahrgenommen wird. Dieses Ergebnis ist für die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überraschend vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Diskussion um digitales Lernen und der damit zusammenhängenden Herausforderungen. „Berufliche Lehrkräfte haben die Herausforderungen in der Pandemie erstaunlich gut bewältigt und können somit als ‚Hidden Champions der Pandemie‘ beschrieben werden“, sagt Karl-Heinz Gerholz.
Die Studie macht in diesem Zusammenhang jedoch auch folgenden Zusammenhang deutlich: War die technische Ausstattung gut und haben Lehrkräfte eine digitale Selbstwirksamkeit, war ihr Stressempfinden gering. Schlechte technische Ausstattung führte dagegen zu sehr hohem Stressempfinden und persönlicher Überlastung.
Neue Arbeitsmodelle in der digitalen Transformation
Zudem leiten die Forschenden aus ihrer Studie ab, dass im Zuge der digitalen Transformation auch die Arbeitsmodelle von Lehrkräften in den Blick genommen werden müssen. „Wenn Unterricht und schulische Arbeit zunehmend in hybriden Räumen stattfinden, ist das Präsenzstundenmodell an der Schule nicht mehr zeitgemäß“, sagt Karl-Heinz Gerholz. „Die sich verändernden Verantwortungsbereiche von Lehrkräften müssen in den Arbeitsmodellen stärker berücksichtigt werden.“ Dies zu beforschen, ist das nächste Ziel der Forschungsgruppe Digi-BS. Die vollständige Studie ist hier zu finden.