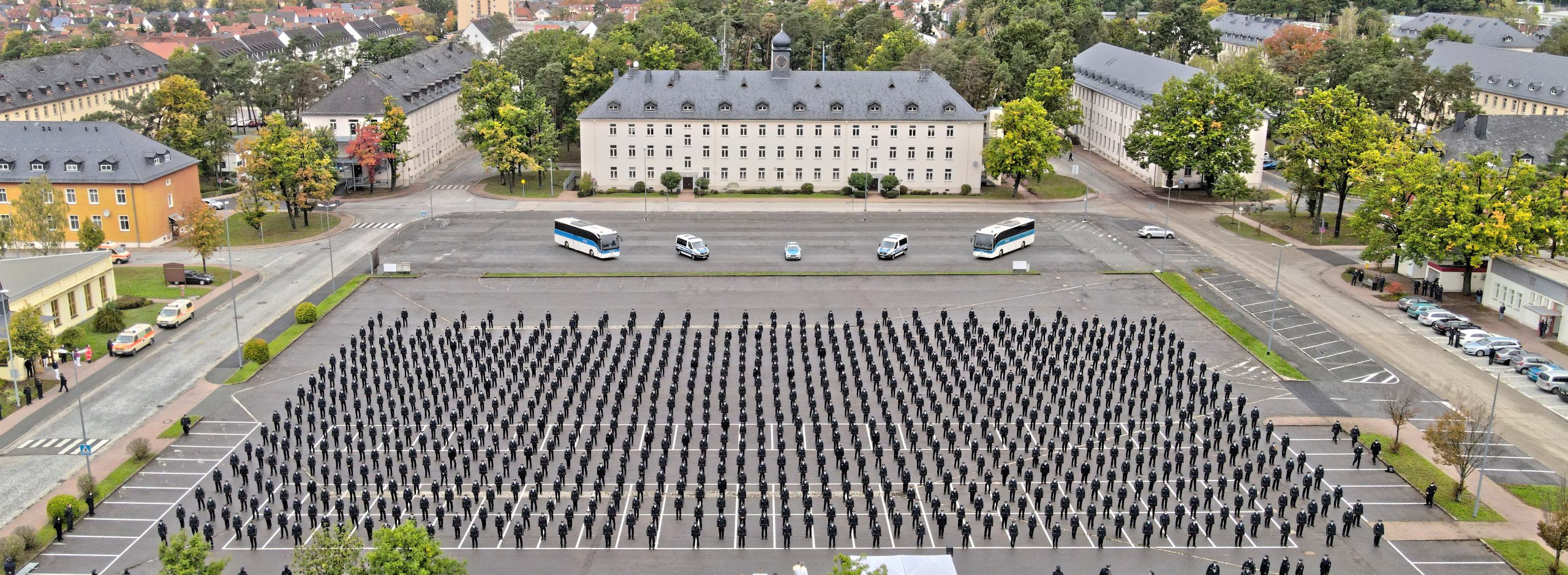Vor zwei Wochen haben 185 deutsche Schauspieler*innen ein vielbeachtetes Manifest veröffentlicht, in dem sie mehr Anerkennung für unterschiedliche sexuelle Orientierungen und mehr Sichtbarkeit für LGBTQI, also homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, queere oder intersexuelle Menschen, in der Film- und Fernsehbranche fordern. Unter dem Titel #actout prangern sie unter anderem an, dass Produktionsfirmen noch viel zu oft dazu raten würden, nicht heteronormative sexuelle Orientierungen oder sexuelle Identitäten geheim zu halten, weil ein Outing die Karriere gefährden könnte.
Victoria Weich ist Dramaturgin am ETA Hoffmann Theater. Mit ihr haben wir über das #actout-Manifest gesprochen.
Frau Weich, wie haben Sie die Veröffentlichung des #actout-Manifests zur Kenntnis genommen?
Victoria Weich: Das hat bei mir viel Freude ausgelöst. Ich bin lesbisch und es ist schön, zu anderen dazuzugehören, die den Mund aufmachen und Sichtbarkeit und ihren Platz in der Branche einfordern. Die Probleme, die in dem Manifest angesprochen werden, habe ich allerdings so nicht, weil ich keine Schauspielerin bin und mich nicht auf einer Bühne zeigen muss. Das macht einen großen Unterschied. Zunächst ist das Manifest also etwas Wünschenswertes und Gutes. Und das auf einer so großen Plattform wie dem Magazin der Süddeutschen Zeitung, wo es veröffentlicht wurde. Hinzu kommt aber, dass das Manifest als berechtigte Kritik gemeint ist, und noch viel zu tun ist für die Sichtbarkeit von queeren Schauspieler*innen in der Branche. Solange es so ist, dass Leute im Publikum Anstoß an einem Kuss zwischen Männern nehmen, wie es vor ein paar Jahren bei unserer Inszenierung von „Engel in Amerika” passiert ist, braucht es solche Manifeste.
Das Manifest bezog sich in erster Linie auf den Film- und Fernsehbereich. Wie ist es um die Sichtbarkeit und die Teilhabe von LGBTQI-Menschen in der Theaterszene bestellt?
Victoria Weich: Die Dinge, die #actout formuliert, haben viel mit den Mainstream-Erzählungen zu tun, die vom Fernsehen vermeintlich erwartet werden. Das scheinen Baustellen zu sein, die wir im Theater so nicht haben. Das Theater steht anderen Erwartungen gegenüber als der „Tatort“, das befreit uns auf gewisse Weise.
Woran liegt es, dass die Theaterszene in dieser Hinsicht diverser und fortschrittlicher als Film und Fernsehen ist?
Victoria Weich: Ich denke, Theater hat den Anspruch, Horizonte zu öffnen und über die Welt, an die man gewöhnt ist, hinauszugehen. Eine Vorabendserie hat diesen Anspruch leider weniger. Im Theater sind wir nicht demselben kommerziellen Druck unterworfen wie Film oder Fernsehen und es gibt zahlreiche queere Menschen, die den heteronormativen Laden aufmischen.
Kann ein Outing in der Theaterszene, wie das Manifest es bezüglich der Film- und TV-Branche anprangert, trotzdem ein Wagnis sein, mit dem man Gefahr läuft, sich das Vorankommen in der Karriere zu erschweren?
Victoria Weich: Wenn Besetzungsentscheidungen einer sexistischen Logik folgen, kann das natürlich auch im Theater passieren. Gerade was Begehrlichkeitsstrukturen und Rollenfantasien angeht, gibt es vielleicht in dem einen oder anderen Theater, bei dem einen oder anderen Regisseur, noch Nachholbedarf. Wenn man sich zum Beispiel als lesbisch outet, kann es passieren, dass man nicht mehr in die männliche, heterosexuelle Vorstellung von Attraktivität passt.
Einige Darsteller*innen haben es abgelehnt, das #actout-Manifest zu unterzeichnen und sich somit gleichzeitig zu outen. Können Sie das verstehen?
Victoria Weich: Ja, wenn man Sorge hat, deswegen Nachteile erfahren zu können, natürlich. Es ist sehr verletzend, in der Öffentlichkeit Ablehnung für etwas zu erfahren, das tiefste Charakterstrukturen betrifft, das eigene Leben und Lieben.
Sollte der Einsatz, wie es im Manifest angesprochen wird, für mehr Sichtbarkeit und Gleichberechtigung von queeren Menschen auch dahin gehen, dass queere Rollen nur von queeren Schauspieler*innen gespielt werden sollten?
Victoria Weich: Das ist eine aktivistische Perspektive des Manifests, beziehungsweise der Wunsch, mit der Veröffentlichung von #actout auch etwas Emanzipatorisches und Ermächtigendes zu schaffen. Das ist ein Wunsch, den ich verstehen kann. LGBTIQ-Menschen möchten den Raum haben, sich selbst darzustellen und ihre Geschichte selbst zu erzählen. Dem entgegen steht ein Grundsatz des Schauspiels, nämlich derjenige der Verwandlung, dass alle alles spielen und sich in alles verwandeln können. Genau wie eine homosexuelle eine heterosexuelle Person spielen können möchte, ginge das natürlich auch umgekehrt. Wenn auf der Bühne eine schwule Partnerschaft gezeigt wird, geht es ja vor allem darum, eine Beziehung, die Liebe und die Konflikte, die darin stecken, zu zeigen.
Glauben Sie, das #actout-Manifest wird Strukturen nachhaltig positiv ändern oder wird es mehr oder weniger wirkungslos verpuffen?
Victoria Weich: Ich glaube schon, dass das Manifest Strukturen verändern kann. Es haben relativ viele Menschen unterzeichnet und es geht ja auch darum, überhaupt erstmal zu benennen, wo in der Branche die Probleme liegen. Es macht für das Publikum etwas aus, wenn man lesen kann, dass eine Rollenbeschreibung mit „Adrian, 27, schwul” noch nicht beendet ist, sondern dass man da als Zuschauer*in die eigenen Sehgewohnheiten und Erwartungen, die man an eine bestimmte sexuelle Orientierung oder Identität hat, lernen kann zu hinterfragen. Auch dass das Manifest Dinge öffentlich macht, die sonst hinter verschlossenen Türen stattfinden, ist gut. So werden Machtgefälle oder heterosexistische Strukturen offengelegt. Durch die Anwesenheit von Kritiker*innen fühlen sich Verantwortliche hoffentlich bewogen, es in Zukunft anders zu machen.